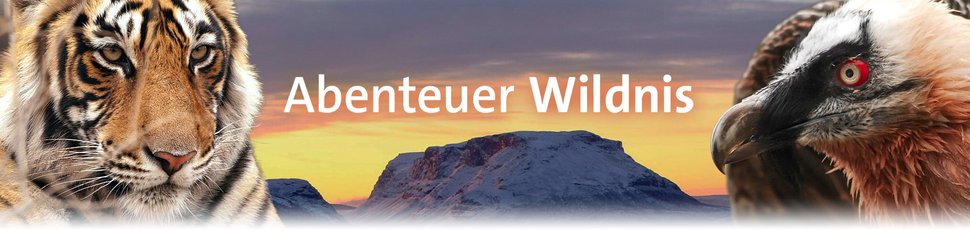553 Folgen erfasst seit 2020 (Seite 17)
Unternehmen Oktopus – Vorstoß ins Reich der Riesenkraken
45 Min.Der Film gewährt mit bestechend schönen Bildern einen seltenen Einblick in das kaum zugängliche Reich der Riesenkraken. Riesenkraken erreichen eine Spannweite von über sieben Metern. Das schwerste bekannte Exemplar brachte 182 Kilogramm auf die Waage. Mit mehr als 2.000 Saugnäpfen und einem scharfen Hornschnabel bewaffnet, sind sie die heimlichen Herrscher in den unterseeischen Kelpwäldern Kanadas. Doch trotz ihrer Größe sind sie nur schwer zu finden. Kaum jemand ist ihnen schon einmal begegnet. Die Journalistin Natali Ricciardi und die Biologin Heidi Windisch wagen sich mit einem Kamerateam ins eiskalte Wasser des Nordpazifiks, um die geheimnisvollen Giganten in ihrem Reich aufzuspüren.Das „Unternehmen Oktopus“ beginnt im Norden von Vancouver Island, Kanada. Mit zentnerschwerem Spezial-Equipment stößt das Team in selten betauchte Gewässer vor. Nach dem Brutgeschäft sterben die Kraken – weshalb, erfährt das TV-Team bei einem Besuch im Seattle Aquarium von Professor Anderson. Im Süden vor Vancouver Island stößt das Team in das Wrack der „C. B. Church“ vor – der gefährlichste Tauchgang des gesamten Unternehmens. 1991 versenkt, um ein künstliches Riff zu schaffen, ist der ehemalige Küstenfrachter heute ein außen prächtig bewachsener Unterwasser-Palast für Riesenkraken. Gleich sechs gewaltige Riesenkraken finden sich hier – packende Eindrücke, die unter die Haut gehen. In der Juan-de-Fuca-Straße setzen die Forscher einen Tauchroboter ein. In 2.000 Meter Tiefe leben Vulkan-Kraken im warmen Umfeld hydrothermaler Quellen, weiß wie die geisterhaften Wunderschirme – Kraken, die durch das Dunkel der Tiefsee gleiten. Aufwendig gedreht gewährt diese Hochglanz-HDTV-Produktion mit bestechend schönen Bildern einen seltenen Einblick in das kaum zugängliche Reich der Riesenkraken – spannend, informativ und gleichermaßen unterhaltend. (Text: BR Fernsehen) Unter Raubkatzen und Ameisenbären – Mit Lydia Möcklinghoff in Brasiliens Tierwelt
45 Min.Mitten im brasilianischen Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Erde, ist die Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff den Geheimnissen der Großen Ameisenbären auf der Spur. Im brasilianischen Pantanal findet man ein einzigartiges Mosaik aus Flüssen, Seen, Sümpfen, Galeriewäldern und Pampa. Weit ab von großen Städten liegen vereinzelt Farmen in der Wildnis. Auf der Farm Fazenda Barranco Alto wird traditionelle Rinderzucht betrieben. Hier befindet sich das Forschungsgebiet von Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff. Mit dem Pferd oder Kanu kommt sie auch an schwer erreichbare Orte, um Kamerafallen aufzustellen.Auf ihrem Weg begegnen ihr kaum Menschen, dafür aber viele Tiere, darunter auch Große Ameisenbären. Sie hat eine Methode entwickelt, mit der sie die einzelnen Ameisenbären unterscheiden kann. Während ihrer langjährigen Forschung hat sich ein zweites Projekt entwickelt. Mithilfe von Kamerafallen sollen alle Säugetiere im Forschungsgebiet erfasst werden. Gerade im Pantanal kann man den großen Erfolg von Artenschutzprojekten tagtäglich erleben. Viele Säugetiere und exotische Vögel waren im 20. Jahrhundert der Ausrottung nahe. Grundlage des Artenschutzes ist die Forschung. Deshalb sind Lydia Möcklinghoff und viele andere Biologen weiterhin im Pantanal unterwegs. Wie zum Beispiel der Jaguarforscher Ge, den Lydia am Fluss trifft. Mit ihm zusammen baut sie eine Falle für die größte Raubkatze Amerikas. Am Abend trifft Lydia Möcklinghoff die Pantaneiros der Farm. Sie erzählen von einem Pumariss und den verheerenden Feuern im Westen und Norden des Pantanals. Diese Brände vernichteten 2020 fast ein Drittel des Gebietes der Größe Großbritanniens. Gefährdet die Klimakrise die Erfolge im Artenschutz? Expertinnen und Experten befürchten eine zunehmende Trockenheit. Das wäre fatal für das riesige Sumpfgebiet. (Text: BR Fernsehen) Urwald von morgen – Nationalpark Eifel
45 Min.Der erste und bislang einzige Nationalpark Nordrhein-Westfalens, südwestlich der Metropole Köln, ist das grüne Herz des Westens und Schauplatz eines wegweisenden Experiments: Auf drei Viertel der Parkfläche wird der ehemalige Wirtschaftswald sich selbst überlassen, die Natur übernimmt Stück für Stück die Hoheit. So entsteht ein Urwald von morgen, der schon jetzt vor allem scheuen Tieren ein einzigartiges Zuhause bietet. Nur fünfzig Kilometer südwestlich der Metropole Köln liegt das „grüne Herz“ des Westens, der einzige Nationalpark Nordrhein-Westfalens.Diese Eifelregion ist Schauplatz eines wegweisenden Experiments: Auf drei Viertel der Parkfläche wird der ehemalige Wirtschaftswald sich selbst überlassen: Tote Bäume werden stehen gelassen, Äste krachen herab und Stämme vermodern am Boden. So entsteht ein Urwald von morgen. Autor Herbert Ostwald erzählt in dieser Dokumentation eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes inmitten einer von Menschen geprägten Umgebung. Abseits der Dörfer und Äcker stehen die heimlichen Rückkehrer im Mittelpunkt. Heimlichtuer, die die Menschennähe nicht mögen, oft scheu und zurückgezogen leben oder ohne Rückzugsorte aussterben würden. Nun schleichen immer mehr Wildkatzen durchs Dickicht, Biber nagen ungestört an Bäumen und Schwarzstörche klappern im Blätterdach. Und selbst die größte Katzenart Europas, der Luchs, ist hier schon gesichtet worden und könnte bald im Urwald auf Jagd gehen. Der Nationalpark ist (noch) keine Wildnis, sondern ein ehemaliger Forst, in dem Bäume nach Festmeter bewertet wurden. Ohne menschliche Pflege und Axt sterben jetzt die angepflanzten Fichten und die ursprünglich beheimateten Buchen kehren zurück. Neu entstehende Laubwälder sind robuster gegen Stürme und Parasiten und bieten im Kronenraum vielfältigere Lebensräume für Tiere und Pflanzen als die eintönigen Fichtenforste, die noch immer große Teile des Nationalparks prägen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden auf unterhaltsame Weise Zeugen eines andauernden Umgestaltungsprozesses in einem menschenverlassenen Schmuckstück der Natur. Geheimnisvoll und spannend erzählt Autor Herbert Ostwald in dieser Dokumentation, wie sich wilde Tiere in ihrem neuen grünen Domizil einrichten. (Text: BR Fernsehen) Usedom – Wellen, Strand und Storchennester
45 Min.Usedom ist Deutschlands zweitgrößte Insel und liegt im äußersten Nordosten der Bundesrepublik Deutschland. Rund ein Fünftel ihrer Fläche gehört heute zu Polen. Das Gesicht der Insel ist vom Wasser geprägt. Mit der Ruhe auf der Insel ist es seit der Wende allerdings vorbei, Jahr für Jahr steigt die Zahl der Urlauber. Usedom ist vom Wasser geprägt: Zwischen Ostseestrand und Binnenküste reihen sich Seen, Moore und Bruchwälder dicht aneinander. Hier leben Sumpfschildkröten, Biber und Fischotter, Kormorane, Kraniche, Seeadler, Watvögel wie Rotschenkel und Austernfischer sowie etwa 1.900 Falterarten. Auch der Flugpionier und Visionär Otto Lilienthal wuchs hier auf. Seine Beobachtungen über die 200 heimischen Vogelarten weckten in ihm den Wunsch, selbst die Welt aus der Luft betrachten zu können; Störche und Möwen wurden für ihn zu Lehrmeistern auf seiner Suche nach dem Geheimnis des Fliegens.Noch immer existiert ein Flughafen auf der Insel. Bis 1990 wurde er vom Militär genutzt, heute dient er zivilen Zwecken. Im wachsenden Tourismus sehen die einen eine Chance für die wirtschaftsschwache Region, andere warnen vor den Gefahren für ihre einmalige Natur. Um diesen Gefahren vorzubeugen, arbeiten seit 1960 auf Usedom und der Nachbarinsel Wollin deutsche und polnische Wissenschaftler und Förster gemeinsam an Schutzstrategien für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. (Text: BR Fernsehen) Das verborgene Leben der Bonobos
45 Min.Obwohl Bonobos die nächsten Verwandten des Menschen sind, weiß man wenig über sie. Immerhin ist bekannt, dass Weibchen und Männchen in der Gruppe gleichberechtigt sind, und dass Sex bei ihnen eine wichtige Rolle spielt: „Make love, not war“ – das ist ihre Methode, um Konflikte zu beheben. Bonobos sind außergewöhnlich friedlich. Doch was ist der Grund für diese besondere Veranlagung? Nur im Kongo haben Forscher aus aller Welt die Gelegenheit, diese faszinierenden Affen besser kennenzulernen. Eine junge Forscherin, Leveda Cheng, will dort die Gruppendynamik der wild lebenden Tiere enträtseln.Dafür muss sie deren Urin sammeln, da dieser Rückschlüsse auf die hormonelle Befindlichkeit zulässt. Die Herausforderung ist groß, zumal die Bonobos unermüdlich querfeldein durchs Dickicht ziehen, dort giftige Schlangen lauern und die Gruppendynamik der Bonobos von einem Augenblick zum nächsten umschlagen kann. Doch der Ehrgeiz der Forscherin ist größer. Sie bleibt den faszinierenden Primaten dicht auf den Fersen, um ihnen das Geheimnis ihrer Friedfertigkeit zu entlocken. (Text: BR Fernsehen) Der Verbündete der Höhlenelefanten
45 Min.Tief bewegt untersucht Ian Redmond einen Elefantenkadaver, der von Elfenbeinjägern erschossen wurde.Bild: BR/Robert Sigl/Text + Bild MedienproduktionIm Mai 2016 wird der renommierte Elefantenforscher Ian Redmond mitten im kenianischen Bergwald völlig unerwartet von einer Elefantenkuh attackiert. Warum hat die Leitkuh, die er Kali nennt, ihn angegriffen? Völlig unerwartet wird der renommierte Elefantenforscher Ian Redmond 2016 mitten im kenianischen Regenwald von einer Elefantenkuh attackiert. Fünf Sekunden lang spielt sie mit ihm Fußball. Ian Redmond überlebt mit Verletzungen, die großteils heilen. Was aber bleibt, ist die drängende Frage: Warum hat die Leitkuh, die er Kali nennt, ihn angegriffen? Warum ausgerechnet den größten „Ele-Friend“? Schon seit den 1980er-Jahren erforscht Ian Redmond, der bereits mit Dian Fossey und David Attenborough zusammenarbeitete, im Gebiet des 4.300 Meter hohen Mount Elgon eine ebenso ungewöhnliche wie gefährdete Population von Savannen-Elefanten.Die Tiere suchen nachts Lavahöhlen auf, um mit ihren Stoßzähnen Gestein von den Wänden zu kratzen. Ian Redmond hat herausgefunden, dass es der Hunger nach Salz ist, der die Tiere in die Höhlen treibt. Auch die Leitkuh Kali, die Ian Redmond angriff, ist Teil der salzhungrigen Herde, die nachts die Lavahöhlen aufsucht. Einmal wurde die Höhle den Tieren schon zur Todesfalle, als Elfenbeinjäger dort einen Teil der Herde erschossen. Könnte sich dieses Erlebnis auch bei Kali abgespeichert haben? Ist ihr oder ihrer Herde der Mensch schon zum Feind geworden – und das nicht nur einmal? Diese Frage treibt Ian Redmond bei seiner Spurensuche im kenianischen Bergwald immer wieder um. Nichts wünscht Ian Redmond sich sehnlicher als seiner Angreiferin Kali wieder zu begegnen. Verziehen hat er ihr längst. (Text: BR Fernsehen) Die verrückte Welt der Hörnchen
45 Min.Ob kanadisches Streifenhörnchen oder das europäische Eichhörnchen – sie begegnen uns auf Spaziergängen in Parks oder im Wald. Ihre akrobatischen Kletterkünste begeistern uns immer wieder aufs Neue: ein filmischer Streifzug durch die Welt der Hörnchen. Knapp 280 verschiedene Arten Hörnchen leben auf vier Kontinenten. Nur Australien, Madagaskar und die Antarktis sind „Hörnchen freie“ Zonen. So groß wie ihr Verbreitungsgebiet sind auch ihre Unterschiede. Es gibt Einzelgänger und Rudelliebhaber, Baumakrobaten und Segelkünstler, Winzlinge und Riesenhörnchen.Einige leben in unterirdischen Städten, wieder andere kommen bei 40 Grad im Schatten erst so richtig in Fahrt. Es gibt mutige Hörnchen, die eine Auseinandersetzung mit einer Kobra nicht scheuen und andere, die sich bei Gefahr schleunigst aus dem Weg machen. So verschieden sie auch alle sein mögen, sie haben doch etwas gemeinsam: Hörnchen sind absolute Anpassungskünstler. Der Filmautor Yann Sochaczewski entführt in die erstaunliche und manchmal auch verrückte Welt der Hörnchen. (Text: BR Fernsehen) Die verrückte Welt der Tintenfische
45 Min.Der Prachtsepia gehört zu den schönsten, aber auch zu den giftigsten Tintenfischen der Welt.Bild: NDR/NDR Naturfilm/doclights/Saint Thomas Productions/Marta SostresIn den Tiefen der Meere lebt eine Gruppe von Tieren mit unglaublichen Fähigkeiten. Knochenlose Kreaturen, die Farbe und Form verändern können. Saugnäpfe machen sie zu effizienten Jägern: Tintenfische. So unterschiedlich wie ihre Fähigkeiten ist auch die Tiergruppe selbst. Was alle vereint: Sie sind intelligent, anpassungsfähig und haben seit Millionen von Jahren die Ozeane der Welt erobert. Oktopusse sind achtarmige Alleskönner und Sepien die Chamäleons der Meere. Sie haben zwei weitere Tentakel, die sie entfalten können, um Beute zu machen.Genauso wie Kalmare. Sie haben besonders große Augen, mit denen sie sogar in der Tiefsee leben können. Was alle vereint: Sie sind intelligent, anpassungsfähig und haben seit Millionen von Jahren die Ozeane der Welt erobert. Vor der Küste Brasiliens leben besonders räuberische Kraken, die bei der Jagd auf Krabben sogar an die Oberfläche kommen. Bei Ebbe lauern sie ihrer Leibspeise im seichten Wasser auf. In der Tiefsee lauern skurrile Tiere wie der Vampirtintenfisch. So gruselig sein Name auch klingt, er ernährt sich ausschließlich von zerfallenden organischen Stoffen im Wasser. Riffkalmare sind Rekordbrecher im Tierreich: Sie kommunizieren, indem sie mehrmals pro Sekunde die Farbe wechseln können. Sie haben noch einen weiteren Trick in petto: Mit der einen Körperhälfte drohen sie ihren Konkurrenten und mit der anderen locken sie Weibchen an. Der Mimik-Oktopus hat eine ganz eigene Methode, seinen Feinden aus dem Weg zu gehen. Er kann nicht nur Farbe und Form verändern, er ahmt sogar das Verhalten anderer Tiere nach. Von der Seeschlange bis zum Feuerfisch, bis zu 15 verschiedene Tierarten hat er im Repertoire. Im Nordwesten der USA ist Meeresbiologe und Tierfilmer Florian Graner einem besonderen Tintenfisch auf den Fersen: dem Pazifischen Riesenkraken, dem größten Oktopus der Erde! Dank seiner langjährigen Erfahrung mit Tintenfischen, weiß Florian Graner, wo er nach dieser Tintenfischart suchen muss. Doch was passiert, wenn Mensch und Riesenkrake aufeinandertreffen? (Text: BR Fernsehen) Verrückt nach Schafen: Der Schäfer aus dem Pfaffenwinkel
45 Min.Dem Beruf des Schäfers wird viel Romantik nachgesagt, aber es ist in Wahrheit ein Knochenjob. Markus Schnitzler ist Schäfer aus Leidenschaft und mit 130 Schafen einer der Letzten seiner Art am bayerischen Ammersee. In dieser idyllischen Landschaft des Voralpenlandes züchtet er mit viel Hingabe zwölf verschiedene Schafrassen, obwohl sein ursprünglicher Hauptberuf eigentlich Metzger ist. Am bayerischen Ammersee züchtet Schäfer Markus Schnitzler mit viel Hingabe zwölf verschiedene Schafrassen, obwohl sein ursprünglicher Hauptberuf eigentlich Metzger ist. Mit einem Teil der Herde macht der Schäfer Tiertherapie in einer psychosomatischen Klinik. Den Rest der Herde treibt er jeden Sommer in die Berge, auf eine Alpe im Allgäu.50 Hektar saftige Kräuterwiesen – ideal für die Tiere! Aber der Weg dorthin ist anstrengend und gefährlich. Knapp 1.000 Höhenmeter auf einem steilen, schmalen Steig gilt es zu überwinden. Nach einem gefährlichen Aufstieg bei Regen steht der Schäfer vor einer schweren Entscheidung. Ein Jahr hat ein Filmteam den Schäfer begleitet, ein dramatisches Jahr, das aber auch ganz neue Chancen für ihn bringt. Der Film „Verrückt nach Schafen“ führt ein in die archaisch bodenständige Welt des Schäferdaseins in der grünen, bäuerlich geprägten Region des Ammersees und den wilden Allgäuer Bergen mit ihren hoch gelegenen Graskuppen. (Text: BR Fernsehen) Vietnam, die letzten Pangoline
52 Min.Acht Arten des Schuppentiers, auch Pangolin genannt, gibt es weltweit. Jede davon ist akut vom Aussterben bedroht. Grund ist zum einen die verstärkte Nachfrage in asiatischen Restaurants nach Pangolinfleisch, zum anderen die Verwendung der Schuppen in der traditionellen chinesischen Medizin. Ein Schutzzentrum in Vietnam will beschlagnahmte Tiere auf ihre Auswilderung vorbereiten. Kaum ein Säugetier wird weltweit so häufig gewildert wie der Pangolin, auch Schuppentier genannt. Wenn nicht bald etwas passiert, werden Pangoline in wenigen Jahren von der Erde verschwunden sein.Das Filmteam hat ein Schutzzentrum in Vietnam besucht. Um den Pangolin steht es schlecht. Mit diesem Säugetier wird weltweit illegaler Handel getrieben. Das Geschäft ist lukrativ, die Gewinnspanne enorm. Ihren Schuppen, die wie unsere Fingernägel aus Keratin bestehen, werden Heilkräfte nachgesagt. Sie sollen den Milchfluss stillender Mütter stimulieren, Asthma und Schuppenflechte heilen. Das Fleisch gilt für viele Asiaten als Delikatesse und der Verzehr als Statussymbol. Pangoline lassen sich schwer züchten und sterben schnell in Gefangenschaft. Kaum jemand kennt sie, kaum jemand schützt sie. Seit Ende der 1990er-Jahre ist in Vietnam zwar die Jagd auf die Tiere verboten, gewildert werden sie trotzdem. Allein in den letzten zehn Jahren wurden weltweit über eine Million Pangoline illegal gehandelt. Lange Zeit wussten die vietnamesischen Behörden nicht, wie sie mit konfiszierten Tieren, von denen die meisten krank und geschwächt sind, umgehen sollten. Das Rettungszentrum im Cuc Phuong Nationalpark, 140 Kilometer südwestlich von Hanoi, entstand aus dieser Notlage. 20 Mitarbeiter arbeiten heute hier, nehmen beschlagnahmte Tiere auf und pflegen sie gesund. Der 25-jährige Tierarzt Lam Kim Hai gehört zu ihnen. Ständig kommen neue Tiere hinzu. Nun endlich sollen 25 von ihnen ausgewildert werden. Ein großer Moment für das Zentrum und Lam Kim Hai. Und eine kleine Chance für den Pangolin, dass die Art vielleicht doch überlebt. (Text: BR Fernsehen) Die Viktoriafälle – Afrikas Garten Eden
45 Min.Schon aus 30 Kilometer Entfernung kann man es sehen: Wie bei einem brodelnden Vulkan erhebt sich eine glutrote Wolke aus der Erde. So erlebt man die Viktoriafälle bei Sonnenaufgang. „Der Rauch, der donnert“, nennen ihn deshalb die Einheimischen. Der Wasserfall im Herzen Afrikas stürzt über eine Breite von fast zwei Kilometern über mehr als 100 Meter in die Tiefe. 1855 entdeckte David Livingstone die Fälle. Tief beeindruckt beschrieb er den Wasserfall als das Schönste, das er je in Afrika zu Gesicht bekam. Er benannte ihn daraufhin nach seiner Königin.Tatsächlich sind die Viktoriafälle noch heute ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht. Gegenüber den Wasserfällen existiert ein Miniaturregenwald, entstanden nur durch die lebenspendende Gischtwolke der Viktoriafälle. Jenseits dieser Wälder ist das Land trocken und geht fast nahtlos in die Savanne über. Gerade in der Trockenzeit beginnt daher eine ungewöhnliche Migration: Elefantenfamilien kommen aus dem 100 Kilometer entfernten Hwange-Nationalpark hierher. Während in ihrer Heimat alles vertrocknet ist, gibt es oberhalb der Fälle eine Vielzahl von immergrünen Inseln: kleine Oasen, in denen die Elefanten die Zeit der Dürre verbringen. Mehrmals pro Woche müssen sie die Insel wechseln, sonst wären diese schnell leergefressen. Dann kommt es zu einem wundervollen Spektakel: Überall schwimmen die Elefanten wie an einer Perlenschnur durch den Sambesi. Aber nicht nur die Elefanten unterliegen dem ständigen Wandel zwischen Trocken- und Regenzeit. Marabus und Paviane sind besonders betroffen. (Text: BR Fernsehen) Vögel auf Wohnungssuche
Wieso brütet der Flussregenpfeifer seine Eier einfach zwischen den Steinen einer Kiesbank aus? Sind die Risiken auf dieser Art Präsentierteller spätestens für die Jungvögel nicht viel zu groß? Offenbar geht es auch anders wie in „Abenteuer Wildnis“ gezeigt wird. Am Beispiel von Specht, Wiedehopf, Star und anderen Höhlenbrütern werden Strategien aus der Tierwelt gezeigt, die den Nachwuchs mehr oder weniger von der Umwelt abschotten und so vor Gefahren schützen. Nachgefragt wird, ob z. B. die Nester von Beutelmeise und Bienenfresser den Naturgewalten und den Fressfeinden besser trotzen. Auch Säugetiere und Insekten vertrauen auf Höhlen – selbstgefertigte oder schon vorhandene. Wieweit sich bestimmte Brutstrategien durchsetzen konnten, und wie es mit den Vor- und Nachteilen im täglichen Überlebenskampf aussieht, zeigen diese filmischen Beobachtungen aus dem Alpenraum. (Text: BR Fernsehen)Von Äpfeln, Wildgänsen und Teichrohrsängern
45 Min.Biotope erhalten die Artenvielfalt am Bodensee. Am Bodensee in der Nähe von Überlingen findet man die am intensivsten genutzten Obstanbauflächen Deutschlands. Kulturlandschaft, so weit das Auge reicht. Doch mittendrin erhält die Natur ihren Anteil zurück. Sie bekommt es in Form von renaturierten Parzellen, wo sich auch Wildgänse, Störche und Teichrohrsänger wohlfühlen. Die Idee, hier einzelne Biotope anzulegen und so die Artenvielfalt in dieser Monokulturlandschaft zu beleben, stammt von Prof. Peter Berthold, Emeritus der Max-Planck-Gesellschaft und weltweit anerkannter Ornithologe. So simpel wie eindrücklich fordert er: „Jeder Gemeinde ihren Weiher, dann ist mit dem Artenrückgang Schluss!“ Die Ergebnisse – im Film durch eine Jahresbetrachtung dargestellt – sind schon nach wenigen Jahren verblüffend positiv. (Text: BR Fernsehen)Wächter der Wale
45 Min.An der Nordwestküste Kanadas leben die Walforscherin Janie Wray und ihr Kollege Hermann Meuter. Sie erforschen Buckelwale und Orcas, die direkt hier ihre Jagdreviere haben. Seit mehr als 14 Jahren studieren die beiden das Verhalten und die Kommunikation der Meeressäuger. Wale nutzen die Meerengen vor der zerklüfteten Küste für ihre Wanderungen: Die Nordwestküste Kanadas an der Grenze zu Alaska ist Wildnis – und das Zuhause der Walforscherin Janie Wray und ihres Kollegen Hermann Meuter. Sie leben hier völlig abgeschieden und sind doch nie ganz allein: Direkt vor ihrem Fenster haben Buckelwale und Orcas ihre Kinderstube und ihre Jagdgebiete.Janie und Hermann sind mit Zustimmung der Gitga’at-Küstenindianer hier. Die Gitga’at übergaben ihnen die Insel Gil Island zur Errichtung ihrer Forschungsstation und nahmen die beiden Forscher in ihre Gemeinschaft auf. Die Erkenntnisse der beiden Forscher sollen helfen, dieses einzigartige Gebiet vor dem Zugriff der Ölindustrie zu schützen, die hier eine Tankerroute plant. Jeden der über vierhundert Buckelwale, die inzwischen regelmäßig an die Küste British Kolumbiens kommen, erkennen Janie und Hermann an deren individuell gezeichneten Schwanzflossen. Buckelwale sind eher Einzelgänger und überraschend verspielt: Mit den Jungtieren der hier ansässigen Stellerschen Seelöwen treffen sie sich nicht selten zu einem ausgelassenen Meerestanz. Als ein junges Orcaweibchen bei der Robbenjagd versehentlich auf einem Felsen strandet, zögern die Wächter der Wale nicht eine Sekunde. Zusammen mit den Gitga’at -Indianern halten sie das hilflose Tier stundenlang kühl und feucht. Erst nachdem die steigende Flut den tonnenschweren Orca aus der Falle befreit, kann dieser zu seiner wartenden Familie zurückkehren. (Text: BR Fernsehen) Das wahre Dschungelbuch
45 Min.Im tiefsten Winter Nordamerikas hat der britische Autor Rudyard Kipling Geschichten geschrieben, die in einem abenteuerlichen Dschungel mitten im tropischen Indien spielen. Sein literarisches Meisterwerk „Das Dschungelbuch“ entstand 1894. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesen Geschichten? Und wie leben die Tiere des Dschungels wirklich? Dieser Naturfilm dokumentiert den täglichen Überlebenskampf der Helden aus Kiplings Erzählungen in der heutigen modernen Welt. „Das Dschungelbuch“ des britischen Autors Rudyard Kipling entstand 1894. Wie viel Wahrheit steckt in diesen Geschichten? Und wie leben die Tiere des Dschungels wirklich? Der indische Kameramann Kalyan Varma, der australische Regisseur Jeremy Hogarth und der österreichische Filmproduzent Lukas Kogler haben mehr als vier Jahre lang an diesem außergewöhnlichen Projekt gearbeitet.Ihnen ist es gelungen, beeindruckende Szenen festzuhalten. Darunter die eines Tigers, der sich hinkend auf die Jagd begibt, ganz wie Shir (Shere) Khan aus dem „Dschungelbuch“, der ebenfalls mit einem lahmen Fuß zu kämpfen hatte. Sie beobachten einen Lippenbären, der seine Jungen großzieht und beschützt, ähnlich wie Balu es mit Mogli gemacht hat. Kaa, ein riesiger Python, trägt mit seiner Beute, einem Axishirsch, einen Todeskampf aus, während ein großer, alter Elefant wie Hathi es war, beinahe lautlos als Einzelgänger den Dschungel durchwandert. Dieser Dokumentarfilm ist eine Hommage an ein großes literarisches Werk und an die unvergleichliche Natur des bevölkerungsreichsten Landes der Erde. Zudem zeigt der Film, dass in diesen alten Geschichten auch immer ein Körnchen Wahrheit steckt. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sie bis heute weltweit für Begeisterung sorgen. (Text: BR) Der Wald der wilden Katzen
Im Harz leben die einzigen beiden wilden Katzenarten Deutschlands gleichzeitig. Luchs und Wildkatze teilen sich ein riesiges Gebiet von über 2.000 Quadratkilometern. Doch jetzt werden die Katzen-Reviere knapp. Die ersten Nachkommen müssen den „Wald der wilden Katzen“ verlassen und neue Reviere erobern … Luchs und Wildkatze teilen sich im Harz ein riesiges Gebiet – Gebirge und Vorland zusammen über 2.000 Quadratkilometer. In der Mitte thront der über elfhundert Meter hohe Brocken. Dass beide Katzenarten hier zu entdecken sind, ist keine Selbstverständlichkeit.Raubtiere hatten und haben es schwer im dicht besiedelten Deutschland. Erst seit dem Jahr 2000 wurden die „Pinselohren“ wieder angesiedelt. Inzwischen leben schon 55 erwachsene und 35 Jungluchse hier. Auch die Wildkatze wurde bejagt und stark zurückgedrängt. Ihre Art überlebte nur in kleinen, inselartigen Gebieten. Sonnige Waldsäume und leuchtende Bergwiesen sind das Jagdgebiet der Wildkatze. Der Reichtum an natürlichen Strukturen hat ihr das Überleben im Verborgenen ermöglicht und bietet heute über 500 Tieren Schutz. Doch nun werden die Reviere knapp. Die ersten Nachkommen müssen den „Wald der wilden Katzen“ verlassen und neue erobern. Kein einfaches Unterfangen. Denn Straßen und zersiedelte und bewirtschaftete Flächen hemmen die Wanderungen von Deutschlands wilden Katzen. Wo aber Wildbrücken und -zäune das sichere Queren von Autobahnen und Schnellstraßen ermöglichen, lassen sich selbst entfernte Naturräume miteinander vernetzen und ermöglichen so eine Ausbreitung von Wildkatze und Luchs in Deutschland. (Text: BR Fernsehen) Der Waldrapp – Zugvogel im Aufwind
50 Min.Im Schatten einer bayerischen Burg brüten skurrile Vögel, die wie Fabeltiere anmuten: Waldrappe. Vor 400 Jahren ausgerottet, haben sie nur in Zoos überlebt. Von Menschen aufgezogene Küken wurden erstmals vor wenigen Jahren in Burghausen angesiedelt. Allein suchen sie Nahrung und ziehen ihre Jungen auf. Doch überall lauern auch Gefahren. Im Schatten der malerischen Burg in Burghausen leben skurrile Vögel, die wie Fabeltiere anmuten: Waldrappe. In einem künstlichen Nistplatz brütet hier die erste Kolonie der Ibisvögel in Mitteleuropa.Bis ins Mittelalter waren die gänsegroßen Tiere mit dem dunklen Gefieder weit verbreitet. Doch sie wurden gejagt und vor etwa 400 Jahren ausgerottet. Zwar überlebten einige wenige Tiere in Marokko und Syrien, doch erst in Zoos konnten sie in größerer Zahl erfolgreich gezüchtet werden. Naturschützer kamen auf die Idee, Waldrappe auszuwildern. Sie starteten ein aufwendiges Projekt. Denn die Nachkommen von Zoovögeln mussten von Menschen lernen, wohin sie ins Winterquartier fliegen müssen. Mit Ultraleichtfliegern wurde ihnen der Weg von Burghausen nach Italien gezeigt. Von allein kehrten die Vögel zurück und brüten seit 2011 erfolgreich an der Burgmauer der bayerischen Kleinstadt. Corinna Esterer und Oliver Habel vom Waldrappteam beobachten in Burghausen die Brutkolonie. Erstmals beobachtet eine Kamera am Nest hautnah die gesamte Brutzeit. Und nie zuvor gelang es, einem Waldrapp eine Kamera auf den Rücken zu schnallen und seinen Flug aus der Vogelperspektive zu erleben. Ein Jahr lang folgt das Filmteam den Tieren von Deutschland bis nach Italien. (Text: BR Fernsehen) Ein Wald voller Gespenster – Lemuren im Dschungel Madagaskars
Im Westen Madagaskars, fernab von jeder Zivilisation, liegt der Kirindy-Wald. Hier leben seltsame Tiere, die zur Verwandtschaft der Affen gehören. Wegen ihrer nächtlichen Lebensweise und ihres seltsamen Aussehens werden sie Lemuren genannt, wie die römischen Totengeister. Ihr heimliches Leben wurde bisher kaum erforscht. Im Westen Madagaskars leben Lemuren, die mit den Affen verwandt sind. Deutsche Wissenschaftler wollen herausfinden, wie diese extravaganten Tiere in ihrer extrem kargen Umwelt überleben.Kameramann Gerd Weiss und Autor Michael Miersch begleiten zwei junge Forscherinnen aus Göttingen auf ihren Streifzügen durch den Kirindy-Wald. Dabei entdeckten sie Zwergmausmakis. Diese Lemuren sind die kleinsten Lebewesen aus der Ordnung der Primaten. Und sie treffen auf Sifakas, Lemuren, die zehn Meter weit von Wipfel zu Wipfel springen können. Das Dschungelcamp der deutschen Zoologen ist immer wieder Schauplatz unverhoffter Begegnungen mit wilden Tieren. Eines Tages drang eine Fossa ins Camp ein. Das größte Raubtier Madagaskars ist höchst selten und gilt als extrem scheu. Vom Camp aus erkundet das Team die Insel. Madagaskar ist ein Versuchslabor der Evolution, das nicht nur Wissenschaftler fasziniert. Die Pflanzen- und Tierwelt entwickelte sich dort ganz anders als auf dem Kontinent. Denn vor 150 Millionen Jahren trennte sich Madagaskar von Afrika ab und das Leben nahm hier eigene Pfade. Dadurch lebt die Mehrheit der Organismen exklusiv auf der Insel. Allein 11.000 Pflanzenarten wachsen nur dort. (Text: BR Fernsehen) Wale – Clevere Giganten
45 Min.Sie sind die größten Tiere, die die Erde bevölkern, schwebende Giganten im Ozean: Wale. Doch der Mensch weiß nahezu nichts über das, was sie in ihrem Innern bewegt. Bei all seinen Begegnungen des Filmautors mit Schwert- und Buckelwalen, Grau- und Pottwalen erlauben die großen Meeressäuger intime Einblicke in ihr Leben, mit Neugier und Respekt begegnen sich beide Seiten. Erst ganz allmählich kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den hohen Intelligenzleistungen der Wale auf die Spur. Auch Meeresbiologe und Naturfilmer Rick Rosenthal taucht seit Jahrzehnten mit Walen, seine Erfahrungen zeigen ihm deutlich: Wale sind nicht nur clever, sie reagieren auch emotional.Rick Rosenthal bricht auf zu einer besonderen Reise: von Alaska über Mexiko zu den klaren Gewässern vor den Cook Islands, nach Norwegen, zu den Falklandinseln und Azoren. Bereits im Anflug auf die felsige Küste Alaskas entdeckt Rick Rosenthal aus dem Flugzeug ein einsames Buckelwalweibchen, das in extrem flachem Wasser schwimmt. Es macht dem Besitzer einer Zuchtfarm für Lachse das Leben schwer. Denn während Buckelwale normalerweise kein Interesse an jungen Lachsen haben, ist dieses Weibchen auf den Geschmack gekommen: Seit Jahren taucht es genau dann auf, wenn die kleinen Lachse in der Bucht freigelassen werden. Routiniert zirkelt das Walweibchen die Fische ein, erledigt Tausende in nur wenigen Sekunden. Dieses Kalkül und diese Präzision faszinieren selbst Wissenschaftler. Orcas sind berühmt dafür, erfolgreich im Team zu jagen. In den eisigen Gewässern Norwegens erlebt Rick, wie routiniert die Schwertwale Sardinen in die Enge treiben. Gemeinsam kesseln sie ganze Schwärme ein, drängen sie gegen die Fjordküste und können es sich sogar leisten, wählerisch zu sein: Das Nahrungsangebot ist derart üppig, dass die Orcas hier nur die „Filestücke“ ihrer Beute fressen, Fischkopf und -flossen bleiben übrig. In der Baja California vor Mexiko herrscht dagegen Nahrungsknappheit. Dort müssen Orcas wehrhafte Beute erlegen, um überleben zu können: Im Zweierteam machen die Schwertwale Jagd auf giftige Stachelrochen. Erstmals gelingen Rick Filmaufnahmen, die zeigen, wie sie Stachelrochen brutal und extrem effizient „entwaffnen“. Vor den Cook Islands wird Rick selber zum „Kulturforscher“ der Wale: Bei einem seiner Tauchgänge im kristallklaren Wasser lauscht er den Liedern zweier männlicher Buckelwale. Die beiden Gesänge unterscheiden sich zunächst, doch nach einer Weile beginnt Rick, Ähnlichkeiten herauszuhören. Die weltbekannte Buckelwalforscherin Nan Hauser hilft Rick zu verstehen, was er in diesem Moment live hört: Die beiden Buckelwale lernen Strophen voneinander und übernehmen das Gehörte in ihr eigenes Lied. Auf diese Weise transferieren die Männchen Informationen, die über Tausende Kilometer weitergegeben werden. Für die Forscher ein Beweis von Kultur unter Walen, für Rick darüber hinaus ein äußerst bewegender Moment auf seiner über zwei Jahre andauernden Reise. (Text: BR Fernsehen) Wales – Der Wilde Westen Großbritanniens: Die Sommerhitze schlägt zu (The Heat is On)
45 Min.Wales, im Südwesten Großbritanniens, besteht aus ganz außergewöhnlichen Landschaften. Egal wo, ob an den Grenzen im Osten, den Tälern im Süden, den Bergen im Norden oder den felsigen Küsten im Westen – überall gibt es unendlich viele Wildtiere. Sogar in unmittelbarer Nähe von Städten. Leicht haben es die Tiere allerdings nicht, weil das Wetter in den verschiedenen Jahreszeiten extreme Bedingungen schafft. Der Sommer hat begonnen. Seeschwalben, die unmittelbar am Strand brüten, sind ständig bedroht von Möwen, die ihre Küken jagen wollen.Doch obwohl sie viel kleiner sind, schaffen es die Seeschwalben, ihre Feinde auf eindrucksvolle Weise zu vertreiben. Schwieriger ist es dagegen, sich gegen etwas zu wehren, das trotz dieser trockenen Jahreszeit bedrohlich ist: gegen Wasser. Denn die Flut ist derzeit gewaltig und überspült die Eier wie auch die bereits geschlüpften Küken. Ramsey Island wird jedes Jahr von Kegelrobben aufgesucht. Im Moment aber nur von Weibchen, die hier ihre Jungen zur Welt bringen und dann füttern müssen. In nur gut zwei Wochen verlieren sie dadurch ein Drittel ihres Körpergewichts, denn sie fressen nun gar nichts mehr. Es wird also Zeit, dass sich die Jungen bald selbst versorgen können. Deshalb beginnt der Schwimmunterricht. Viele Wildtiermännchen wollen sich inzwischen wieder paaren, was die Weibchen aber stört, weil sie ja ständig für ihre Jungen da sind. Deshalb wehren sie sich dagegen. Wie sie das machen, zeigt – neben anderen Problemlösungen – diese Folge von „Wales – Der Wilde Westen Großbritanniens“. (Text: BR Fernsehen) Wales – Der Wilde Westen Großbritanniens: Ein schwieriges Frühjahr (The Trials of Spring)
45 Min.Der Frühling in Wales war zunächst extrem kalt. Inzwischen ist er aber viel wärmer als in anderen Jahren. Die Tiere, die ihr Futter aus der Erde holen müssen, kämpfen nun mit dem trockenen Boden. Für Papageientaucher, die ihre Fische bis zu 70 Meter tief aus dem Meer fangen, ist das natürlich kein Problem. Sie haben aber ein anderes: Einen Feind, der zwar ein schlechter Fischer ist, aber ein hervorragender Dieb. Er stiehlt ihnen das Futter – und frisst sogar ihre Küken. Eine Bedrohung, die auch Kiebitze erleben.Doch sie können ihre Feinde angreifen, obwohl sie nur halb so groß sind. Denn ihre Manövrierfähigkeit beim Fliegen ist wesentlich besser. Es gibt allerdings noch andere Gefahren, die nichts mit anderen Tieren und natürlichen Feinden zu tun haben, sie aber durchaus betreffen. Der anstehende Sommer wird extrem heiß und die Landschaft immer trockener – bis schließlich Waldbrände den Lebensraum der Wildtiere zerstören. Davon erzählt diese Folge von „Wales – Der Wilde Westen Großbritanniens“. (Text: BR Fernsehen) Wales – Der Wilde Westen Großbritanniens: Langer Winter – Später Frühling (The Return of The Sun)
45 Min.Der erste Tag des Frühlings fühlt sich in diesem Jahr eher wie ein arktischer Winter an. Ein Sturm aus dem Osten hat Wales mit Schnee bedeckt, quer über das Land von der Grenze im Osten bis zu den Tälern im Süden und den Bergen im Norden. Der Winter scheint nicht zu Ende zu gehen. Und das Leben vieler Wildtiere ist dadurch sehr gefährdet. Es ist ein dramatischer Start in ein Jahr voller Herausforderungen. Die Tiere reagieren darauf aber nur bedingt, denn viele sind trotz der Kälte schon mehr als bereit, sich wieder zu paaren. Unterschiedlichste Arten wie Wildpferde, Moorhühner, Wasseramseln, Kreuzkröten, Haubentaucher, Papageientaucher oder Zauneidechsen schaffen es auch in diesem kalten Frühling, für Nachwuchs zu sorgen.Das Wetter spielt dabei offenbar nur eine geringe Rolle. Die Konkurrenten hingegen schon eher, denn sie sorgen für Kämpfe, die durchaus gefährlich sein können. Erstaunlicherweise ändert sich das Frühlingswetter extrem. Zuerst war es zu kalt, dann wird es zu warm. Wie die Tiere das verkraften, und was sie unternehmen, um ihren inzwischen auf die Welt gekommenen Nachwuchs zu versorgen und zu schützen, zeigt diese Folge von „Wales – Der Wilde Westen Großbritanniens“. (Text: BR) Wales – Der Wilde Westen Großbritanniens: Stürmische Herbst-Gefahren (The Gathering Storm)
45 Min.Der Herbst hat in Wales begonnen. Für die wildlebenden Tiere beginnt jetzt eine kritische Jahreszeit, in der sich einige auf den Mangel an Nahrung vorbereiten. Nach Bränden kommen nun Fluten, die die Wildtiere in Wales vor neue Herausforderungen stellen. Manche beginnen zu kämpfen, andere suchen nach Partnern und müssen sich bei der Paarung an ihren Rivalen messen. Der Spätherbst in Wales ist der Beginn einer Sturmsaison. Jetzt vernichten nicht Brände, sondern gigantische Fluten die Lebensräume an der Küste. In den Bergen dagegen bekommt man von diesen Problemen weniger mit, denn es gibt andere Aktivitäten.Ein Rothirsch hat seine Rivalen besiegt und sollte sich jetzt paaren. Andere Wildtiere haben es viel schwerer, für Nachwuchs zu sorgen. Lachse, die im Fluss Vyrnwy geboren wurden, kommen nun nach drei Jahren aus dem Atlantik zurück. Doch ihr Heimatfluss ist vom Herbstregen durchflutet. Trotzdem müssen die Lachse hinaufschwimmen und an den zahlreichen Wasserfällen sogar hinaufspringen. Nun steht der Winter an, mit Kälte und Mangel an Futter. Trotzdem werden die walisischen Wildtiere überleben. Denn auch in diesem Jahr der Extreme haben die meisten alles geschafft, was die vier sehr unterschiedlichen Jahreszeiten ihnen abverlangt haben. Wales – im Südwesten Großbritanniens – besteht aus ganz außergewöhnlichen Landschaften. Egal wo, ob an den Grenzen im Osten, den Tälern im Süden, den Bergen im Norden oder den felsigen Küsten im Westen – überall gibt es unendlich viele Wildtiere. Sogar in unmittelbarer Nähe von Städten. Leicht haben es die Tiere allerdings nicht, weil das Wetter in den verschiedenen Jahreszeiten extreme Bedingungen schafft. (Text: BR Fernsehen) Wales – Großbritanniens wilder Westen
45 Min.Wales ist der kleinste Landesteil Großbritanniens und steckt voller Mythen und Legenden. Schroffe Gebirge im Norden, sanfte Hügellandschaften im Süden und raue Klippen entlang der Küste. Eine Region der Gegensätze. So hat sich auch J. R. R. Tolkien für seine weltberühmte Trilogie „Der Herr der Ringe“ von der Landschaft inspirieren lassen. Im Norden von Wales liegt Snowdonia, eine Berglandschaft mit spektakulärer Kulisse: Wildziegen tragen im Herbst heftige Brunftkämpfe aus. Ihre enge Verwandtschaft mit Steinböcken wird dabei offensichtlich.Im Süden von Wales liegt die Region der Brecon Beacons: Die Hügellandschaften erinnern stark an das von J. R. R. Tolkien beschriebene Auenland und sind auch die ideengebende Region dafür. Während hier in den niederen Lagen Füchse ihren lebhaften Nachwuchs aufziehen, durchstreifen frei lebende walisische Bergponys die riesigen Graslandschaften der höheren Lagen. An der rund 2.700 Kilometer langen Küste leben etwa 5.000 Kegelrobben. Im Herbst werden die Jungtiere geboren und müssen oftmals verheerenden Stürmen trotzen. Die nur drei Quadratkilometer große Insel Skomer ist die Heimat von bis zu einer Dreiviertelmillion Seevögeln. Die Stars unter ihnen sind die unverwechselbaren Papageitaucher. Nachdem sie acht Monate auf dem offenen Meer verbracht haben, kehren sie im April nach Skomer zurück, um hier ihren Nachwuchs auszubrüten. Die Felseninsel Skokholm beherbergt eine Brutkolonie von rund 80.000 Basstölpeln, es ist die weltweit drittgrößte Brutkolonie dieser faszinierenden Flugakrobaten. Auch Delfine finden an der walisischen Küste ein üppiges Nahrungsangebot. Dabei bedienen sie sich einer völlig unerwarteten Nahrungsaufnahme. Zwei Jahre lang hat der Naturfilmer Hans-Peter Kuttler die reichhaltige Natur in Wales porträtiert. In diesem Naturfilm wird mit hoch stabilisierten Flug-, Zeitlupen- und Miniaturkameras und Kameraschienen die faszinierende Natur von Großbritanniens wildem Westen hochwertig und aus neuen Blickwinkeln präsentiert. (Text: BR Fernsehen) Wale vor unserer Küste
In der Naturreportage „Wale vor unserer Küste“ zeigt Holger Vogt mit bewegenden Bildern die Welt der Wale vor unserer Küste. Dabei wird deutlich, warum es auch an Nord- und Ostsee so wichtig ist, sich um ihren Schutz zu kümmern. Anfang 2016 stranden 30 Pottwale an der Nordseeküste. 20 von ihnen verenden qualvoll vor deutschen Deichen. Die Bilder der sterbenden Wale bewegten Wissenschaftler, Medien und viele Bürger gleichermaßen. Pottwale sind mit bis zu 20 Metern Körperlänge und 60 Tonnen Gewicht die größten Raubtiere der Erde.Sie jagen in der Tiefsee nach Tintenfischen. Warum haben sich 30 Walbullen in die flache Nordsee verirrt? Der Meeresbiologe, Taucher und Naturfilmer Florian Graner will den Grund für die Strandungen herausfinden. Seine Spurensuche beginnt dort, wo die Pottwalbullen herkamen – am Polarkreis vor Norwegens Küste. Auch andere Walarten, die vor Norwegen leben, tauchen immer wieder hierzulande auf. Seit 2015 werden vermehrt Finn-, Buckel- und Zwergwale sowie Delfine vor unseren Küsten gesichtet. Florian Graner findet überraschende Erklärungen. Eine Walart liegt dem Meeresbiologen besonders am Herzen: der Schweinswal. Er ist unser einziger heimischer Wal und einer der Kleinsten weltweit. Kaum jemand kennt das scheue Tier, das im Sommer vor den Stränden der Nord- und Ostsee seinen Nachwuchs zur Welt bringt. Vor Jahren hat Florian Graner seine Doktorarbeit über den Schweinswal geschrieben. Seitdem hat sich der Lebensraum dieses Tieres dramatisch verändert. Zu den Stellnetzen, in denen viele Wale ertrinken, kommen Schadstoffe und Müll im Meer. Doch die größte Gefahr ist auch für ihn der Lärm, der ständig zunimmt. Vor allem durch die Schifffahrt und die Offshore-Baustellen für Windenergie, deren Rammen das Meer erschüttern. Wale orten mit Schall. Ihre Orientierung und Kommunikation läuft über das Gehör. Wird es durch Lärm geschädigt, können sie keine Nahrung mehr finden und verhungern. Florian Graner trifft Wissenschaftler, die die Schweinswale erforschen, um sie besser schützen zu können. (Text: BR Fernsehen)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail