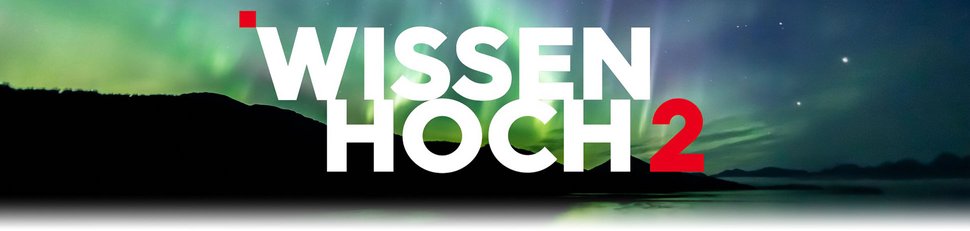119 Folgen, Folge 25–48
25. Hoffnung Palliativmedizin – selbstbestimmt sterben
Folge 25Die Palliativmedizin stellt die Lebensqualität an erste Stelle, nicht die Verlängerung des Lebens um jeden Preis. Oft steht sie jedoch in Konflikt mit lebenserhaltenden Maßnahmen. Mediziner kämpfen mit allen Mitteln gegen Krankheit und Tod – nicht selten auch auf Kosten des Patientenwohls. Das Lebensende ist ein Milliardengeschäft mit Hightech-Medizin, die bei Sterbenden manchmal mehr Leiden verursachen kann als Linderung. Wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, um sich gegen eine lebensverlängernde und für eine palliative Behandlung zu entscheiden? Und was muss man über den Sterbeprozess wissen, um diese Entscheidung treffen zu können?Um diese Frage zu beantworten, begleitet die Wissenschaftsdokumentation „Hoffnung Palliativmedizin – selbstbestimmt sterben“ Betroffene wie den 47-jährigen Frank Desens, der an Blasenkrebs erkrankt ist und bei dem keine Therapien mehr anschlagen, besucht eine Palliativstation in Offenbach und befragt einen der führenden Palliativmediziner Europas, Gian Domenico Borasio.Er hat den Ausdruck des „liebevollen Unterlassens“ geprägt: „Nicht alles, was die Hochleistungsmedizin kann, muss auch gemacht werden,“ so Borasio. Erst seit 2014 gehört die Palliativmedizin als fester Bestandteil zum Medizinstudium. Schmerzen, Übelkeit und Angst sollen minimiert und auf individuelle Wünsche soll eingegangen werden. Der Neurologe und Palliativmediziner Raymond Voltz war Ende der 1980er-Jahre einer der ersten in Deutschland, die sich für den Fachbereich interessierten. In seiner aktuellen „Last Year Of Life Study“ untersucht er, was Menschen am Lebensende wichtig ist und wo sie sterben wollen, wenn sie die Wahl haben. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Erkrankungen wie Demenz und Krebs nehmen zu und so auch die Zahl schwerkranker, nicht heilbarer Patienten. Die Frage, wie Menschen ihr Lebensende unter diesen Voraussetzungen human gestalten können, ist dringlicher denn je. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 18.02.2021 3sat 26. Die Macht der Vorurteile – Rassismus bewusst verlernen!
Folge 26Menschen jeglicher Hautfarbe und Herkunft sind im Erbgut zu mehr als 99,99 Prozent gleich. Dennoch ist Rassismus im vermeintlich aufgeklärten Deutschland tief verwurzelt. Woran liegt das? Rassistische Denkmuster werden von Menschen und Institutionen reproduziert und durch digitale Technik verstärkt. Sie werden, wie andere kulturelle Verhaltensmuster auch, sehr früh übernommen. Doch weil Rassismus gelernt ist, kann er auch wieder verlernt werden. Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir strukturellen Rassismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen anerkennen und bereit sind, uns intensiv damit auseinanderzusetzen. Die Bildersuche bei Twitter und Google bevorzugt weiße Menschen.Die Gesichtserkennung von Mobiltelefonen kann Asiatinnen nicht voneinander unterscheiden, und Automaten der Bundesdruckerei scheitern daran, biometrische Fotos von Schwarzen zu erstellen. Ähnlich sieht es in der Medizin aus: Fast alle Symptome werden in der Fachliteratur und in Vorlesungen an weißen Menschen abgebildet und beschrieben. Viele Krankheiten werden bei Schwarzen und „People of Color“ später diagnostiziert. Diese erhalten bei gleicher Diagnose niedriger dosierte Schmerzmedikamente, und sie werden ärztlich weniger gut betreut. Die Folge ist eine höhere Sterblichkeit – das zeigt auch die aktuelle Covid-19-Pandemie. Dass Menschen unterschiedlich aussehen, ist eine Folge von Migration und der Anpassungsfähigkeit des Homo sapiens an eine neue Umwelt – und kein Ausdruck von genetischer Andersartigkeit. Menschliche „Rassen“ gibt es nicht, deshalb soll der Begriff aus dem Grundgesetz gestrichen werden. „People of Color“ oder „Menschen of Color“ beschreibt Individuen und Gruppen, die aufgrund körperlicher und kultureller Fremdzuschreibungen der weißen Dominanzgesellschaft als „anders“ definiert werden und so vielfältigen Formen von Rassismus ausgesetzt sind. Wissenschaftliche Studien und Schilderungen von Schwarzen, Musliminnen und Muslimen und anderen „People of Color“ über Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, im Berufsleben, in der Schule und bei Polizeikontrollen dokumentieren dies. Die Annahme einer weißen Überlegenheit ist kein Problem am Rand unserer Gesellschaft, sondern selbst bei Menschen, die erklärtermaßen nicht rassistisch sein möchten, durch Mainstream-Rollenbilder in Schule und Medien geprägt. Wenn wir uns der Vorurteile bewusst werden, kann es gelingen, ihre Macht zu brechen und Rassismus zu „verlernen“. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 25.02.2021 3sat 27. Prostitution: Kein Job wie jeder andere
Folge 27Ist Prostitution ein Beruf wie jeder andere? Sehr liberale Gesetze haben Deutschland zum „Puff Europas“ gemacht. In Schweden hingegen gilt Prostitution als ein Angriff auf die Menschenwürde. In Deutschland hält sich das Bild der selbstbestimmten, emanzipierten Prostituierten, die sexuelle Handlungen verkauft wie eine beliebige Dienstleistung. Man spricht von „Sexarbeiterin“ und ignoriert die Auswirkungen auf einzelne Personen und die Gesellschaft. Sex gegen Geld – weltweit bieten geschätzte 40 Millionen Menschen, meist Frauen, ihren Körper als Ware an.Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Prostituierte durch ihre Tätigkeit in hohem Maß Gefährdungen und Schädigungen an Leib und Seele ausgesetzt sind. Sandra Norak war selbst jahrelang als Prostituierte tätig und sagt: „Ich habe keine einzige Frau getroffen in den sechs Jahren, bei der ich zu 100 Prozent davon überzeugt war, dass sie es wirklich freiwillig gemacht hat. Wenn man 20 Freier am Tag bedienen muss, das ist physisch und auch psychisch nicht zu ertragen. „Warum geht Prostitution uns alle an? „Der Blick des Freiers überträgt sich auf jede Frau außerhalb der Prostitution“, warnt Traumatherapeutin Ingeborg Kraus. Psychotherapeut Lutz Besser betont: „Wenn Frauen als Konsumgut weiter in der Prostitution ungeschützt existieren, dann führt das dazu, dass Gleichberechtigung noch in weiter Ferne ist. „Die schwedische Gesellschaft hat mit dem Verbot des Sexkaufs im Jahr 1999 gute Erfahrungen gemacht und sieht die Rechte der Frauen gestärkt. Immer mehr Länder wie etwa Frankreich folgen Schweden in dieser Auffassung. Ist das nordische Modell das richtige und der deutsche Weg gescheitert? (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 04.03.2021 3sat 28. Baustelle Bürokratie – Warum Großprojekte scheitern
Folge 28Zu spät, zu teuer, zu komplex: Wenn der Staat baut, droht oft Chaos. Ob in Berlin, Hamburg oder Stuttgart – Experten sind sich einig: Der Fehler bei deutschen Großprojekten liegt im System. Komplizierte Genehmigungsverfahren, Planungschaos und endlose Gerichtsverfahren – die Bürokratie steht deutschen Großbaustellen häufig im Weg. Für europäische Infrastrukturvorhaben bedeutet das: Die Nachbarländer bauen, Deutschland plant noch. Großprojekte können fristgerecht fertiggestellt werden – das zeigen Beispiele wie etwa der Schweizer Gotthard-Basistunnel.„Deutschland hinkt bei vielen Projekten völlig hinterher. Gar keine Frage, die Ursachen sind mannigfaltig. Einerseits der Föderalismus, unterschiedliche Interessen, andererseits auch teilprivatisierte Organisationen“, bedauert Reiner Holznagel vom Bund der Steuerzahler. Häufig geraten wirtschaftliche und ökologische Interessen miteinander in Konflikt. Vielerorts gibt es Widerstand aus der Bevölkerung. Der Ruf nach mehr Transparenz und einer professionelleren Bürgerbeteiligung wird in Fachkreisen immer lauter. „Building Information Modeling“ (BIM), eine digitale Planungsmethode, könnte helfen, dass große Bauvorhaben künftig besser gelingen. Doch der Einsatz kommt hierzulande nur schleppend voran. Gespräche mit Bauherren, Bauexperten und Betroffenen zeigen auf, warum öffentliche Großprojekte so häufig aus dem Ruder laufen und was die Lösungsansätze sein könnten. „WissenHoch2“ – ein Thema, zwei Formate: Um 20:15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21:00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit einem interdisziplinären Team von Experten. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 18.03.2021 3sat 29. Abkühlung für heiße Städte
Folge 29Heiße Sommer werden zur Normalität. Beton und Glasfassaden heizen die Städte auf. Nachhaltige Konzepte zu Bepflanzung, Luftzirkulation und Wassermanagement sollen die Innenstädte abkühlen. Städte heizen sich stärker auf als ihr Umland – in Hitzewellen um bis zu acht Grad Celsius. Es bräuchte mehr Grünflächen und Parks, doch gleichzeitig fehlt Wohnraum. Mit einer intelligenten Stadtplanung und Architektur kann Abkühlung der Innenstädte gelingen. Der Sommer 2020 war auf der Nordhalbkugel der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor knapp 150 Jahren.Hitzewellen treffen vor allem die Innenstädte: starke Versiegelung, geringe Begrünung und reduzierte Wind-Durchlüftung führen immer häufiger zu einer Überhitzung. Das Problem: Auch nachts sinken die Temperaturen nicht mehr unter 20 Grad, was zu einer starken gesundheitlichen Belastung führt. Der Klimaforscher Dr. Hans Schipper und sein Team vom Karlsruher Institut für Technologie zeigen anhand von Klimamodellen, dass die Hitzetage weiter zunehmen werden. Aber auch, wie Bepflanzungen das Mikroklima in den Städten beeinflussen: „Die Kühlleistung eines Baumes liegt demnach bei bis zu 30 Kilowatt, das entspricht in etwa zehn Klimaanlagen oder einer gefühlten Temperatursenkung von zehn bis 15 Grad.“ Die Blätter der Pflanzen halten die Feuchtigkeit und verdunsten sie bei Hitze – das ist besser als jeder Sonnenschirm. Wie genau die Pflanzen dabei helfen können, unsere Innenstädte dem Klimawandel besser anzupassen, erforscht Prof. Karl-Heinz Strauch in Berlin. Welche Bäume und Pflanzen eignen sich für die Stadt in Zeiten des Klimawandels?Ein anderer Fokus bei der Kühlung der Innenstädte setzt auf das Wassermanagement. Statt Regenwasser in die Kanalisation zu leiten, wird es in Wasserläufen, Wiesenflächen und Bächen an der Oberfläche gehalten und trägt auch zu einer nachhaltigen Kühlung bei. „WissenHoch2“ – ein Thema, zwei Formate: Um 20:15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21:00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit einem interdisziplinären Team von Experten. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 25.03.2021 3sat 30. Böden im Burnout – wie Chemie Bienen und Äcker bedroht
Folge 30In unserer auf Massenerträge ausgelegten Agrarwirtschaft wird der Boden nicht nur beackert, sondern auch ausgelaugt. Wie wirken Überdüngung und Pestizide auf die Umwelt und den Menschen? Fruchtbare Äcker sind ein sehr kostbares Gut – und lebenswichtig für unsere Ernährung. Der Einsatz von zu viel Chemie ist katastrophal. Pestizide sorgenfür Artensterben, kontaminieren Böden und töten Mikroorganismen ab, die wichtig sind für den gesunden Humusaufbau. Glyphosat, Neonicotinoide, Organophosphate, Pyrethroide: Das sind nur einige von etwa 1000 zugelassenen Pflanzenschutzmitteln in Deutschland.Mit ihnen werden in der Landwirtschaft Schädlinge, Pilze und Wildkräuter vernichtet. Rund 90 000 Tonnen Pestizide kommen pro Jahr zum Einsatz. Ein Milliardengeschäft für Chemieunternehmen. „Neonicotinoide werden durch den Regen in den Boden ausgewaschen. Dort wirken sie hochtoxisch auf viele Organismen … vergiften die Insekten und die Umwelt“, so der Toxikologe Henk Tennekes. Seit Langem stehen Nervengifte aus der Gruppe der Neonicotinoide im Verdacht, weltweit für ein enormes Bienensterben verantwortlich zu sein. Erst 2021, nach fast 30 Jahren, werden die letzten Neonicotinoide EU-weit verboten, obwohl schon früh Studien vor deren Einsatz warnten. Für eine Entwarnung oder ein Aufatmen ist es jedoch zu früh. Zum einen gibt es sogenannte Notfallzulassungen für Neonicotinoide, die das Verbot umgehen. Zum anderen sind ähnlich wirkende Stoffe, deren Auswirkungen aber längst nicht so gut untersucht sind wie bei den Neonicotinoiden, schon längst auf dem Markt. Und: In vielen Ländern außerhalb der EU sind die Pflanzenschutzmittel immer noch erlaubt. Fast 40 Prozent des EU-Budgets gehen in die Landwirtschaft. Die Gemeinsame Agrarpolitik wurde im Oktober 2020 für sieben Jahre neu verhandelt. Eigentlich sollten die durchschnittlich etwa 50 Milliarden Euro Agrarhilfen pro Jahr auch eine umwelt- und klimaschonende Anbauweise fördern. Doch die nun verabschiedete Reform gibt kaum Anlass zu Optimismus. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 08.04.2021 3sat 31. Weltretter Wurzeln – Das Wunder unter der Erde
Folge 31Wurzeln machen über die Hälfte der Masse einer Pflanze aus und sind doch meist unsichtbar. Ihre besonderen Kräfte helfen, Probleme des Klimawandels und Umweltschutzes zu bewältigen. Gerade der unsichtbare Teil der Pflanzen hat das Potenzial, bei den Herausforderungen der Menschheit zu helfen: die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung zu sichern, den Klimawandel zu stoppen und Ressourcen, wie Seltene Erden, umweltfreundlich abzubauen. Dafür müssen Pflanzen jedoch Dürre- und Hitzeperioden aushalten und Überschwemmungen überstehen.Wurzeln sind dabei von entscheidender Bedeutung. Und sie suchen im Boden aktiv nach Nährstoffen und wehren Gefahren wie Krankheitserreger und Gifte ab. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen im Forschungszentrum Jülich das Wurzelwachstum mit Hightech-Verfahren. Das Ziel: stressresistente Samen für Pflanzen mit robusten Wurzeln zu züchten. In Schweden forscht Prof. Linda Maria Mårtensson an einer mehrjährigen Weizensorte, die bodenschonend für höhere Erträge sorgen soll. Und an den Küsten sind Wurzeln Retter in der Not. Der Küstenökologe Prof. Tjeerd Bouma hat entdeckt: Pflanzt man spezielle Gräser vor den Deichen, entsteht dort eine Salzwiese, die wie ein natürlicher Wellenbrecher wirkt. Der Geochemiker Dr. Oliver Wiche von der Technischen Universität Freiberg forscht hingegen am sogenannten Phytomining. Er will wissen, welche Pflanzen sich am besten für den Abbau von Metallen wie Geranium oder Seltenen Erden aus dem Boden eignen. Kann daraus ein neuer, umweltfreundlicher Industriezweig entstehen? (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 15.04.2021 3sat 32. Lebensretter HIV – Virustherapie gegen Gendefekt
Folge 32Das Humane Immundefizienz Virus (HIV) wird bei bahnbrechenden Gentherapien zur Heilung tödlicher Erbkrankheiten eingesetzt. So soll es auch in der Therapie des Sanfilippo-Syndroms helfen. Das Sanfilippo-Syndrom ist eine seltene genetische Stoffwechselstörung im Kindesalter, die das Nervensystem angreift. Sie endet tödlich in jungen Jahren, da bislang ohne Heilverfahren. Eine Gentherapie, die das HI-Virus als Vehikel nutzt, soll Rettung bringen. Zwei bayerische Familien reisen nach Manchester, um ihre Kleinkinder in einer experimentellen Gentherapie der Behandlung des Sanfilippo-Syndroms zu unterziehen.Die Kinder dürfen noch nicht älter als zwei Jahre sein, sonst ist die Krankheit schon zu weit fortgeschritten. Dies ist eine sehr schwierige Zeit, aber es besteht große Hoffnung für Sophia und Jordan. Um den auslösenden Gendefekt der Erkrankung zu korrigieren, hat der Stammzellexperte Professor Robert Wynn vom Royal Manchester Children’s Hospital Milliarden erkrankter Zellen aus dem Knochenmark von Sophia und Jordan entnommen. Die patienteneigenen Stammzellen werden schließlich mithilfe eines viralen Vektors – hier eine Form des HI-Virus – genetisch korrigiert und danach in das Knochenmark zurück implantiert.Die Dokumentation „Lebensretter HIV“ begleitet außerdem den 23 Monate alten Jona aus Stuttgart nach Mailand, wo seine wichtige erste Jahresuntersuchung nach der erfolgten Stammzell-Gentherapie stattfindet. Jonas acht Jahre alter Bruder hat die gleiche Erkrankung. Er kam aufgrund seines Alters jedoch für die Gentherapie nicht infrage, so dass sich die Krankheit jetzt in einem Verlust der Beweglichkeit und der Gehirnfunktion zeigt. Professor Luigi Naldini vom San-Raffaele Gentherapie-Institut in Mailand hat viele Preise für die Erfindung dieser HIV-Vektor-Technik erhalten und sie erstmals bei Kindern mit Leukodystrophie, einer genetisch bedingten Hirnerkrankung, erprobt. Doch das Verfahren bleibt nicht ohne Risiken. „WissenHoch2“ – ein Thema, zwei Formate: Um 20:15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21:00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit einem interdisziplinären Team von Experten. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 29.04.2021 3sat 33. Schwarze Löcher – Ursprung unseres Lebens
Folge 33Das Universum könnte voller Leben sein – Schwarze Löcher verteilten dafür die Bausteine über Milliarden Jahre im All. Astronomen glauben: Ohne sie hätte sich kein Leben auf der Erde entwickelt. Schwarze Löcher dienten als „Elementenmixer“: Ihre kosmischen Gasströme, die „Jets“, schleuderten die Bausteine für komplexe organische Strukturen Lichtjahre weit ins All. Solche lebenswichtigen Elemente sind überall im Universum relativ gleich verteilt. Diese neue Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen. Denn damit herrschen weit draußen im All die gleichen Verhältnisse wie in der Region, in der sich die Erde bewegt.Unser Sonnensystem liegt genau in der Mitte einer lebensfreundlichen, habitablen Zone der Milchstraße und ist damit innerhalb unserer Galaxie ideal platziert. Für die Erde herrschen innerhalb unseres Sonnensystems ideale Bedingungen, damit Leben entstehen kann. Doch es brauchte Geburtshelfer aus dem All: Asteroiden. In ihrem Inneren herrschen ähnliche Umweltbedingungen wie auf der frühen Erde: Hitze, Wasser und wichtige Elemente für die Entstehung von Leben. Forscherinnen und Forscher glauben, dass diese Bausteine des Lebens einst mit den Bruchstücken der Asteroiden, den Meteoriten, auf die Urerde gelangten und dort die Entwicklung des Lebens angestoßen haben. Astrophysiker sind inzwischen in der Lage, einen Bogen vom Urknall bis hin zu unserer DNA zu schlagen: „In gewisser Weise kann man tatsächlich sagen: Die Schwarzen Löcher bedingen das Leben“, so der Radioastronom Prof. Michael Kramer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Schwarze Löcher sind das größte Rätsel im Universum. Weltweit gibt es dazu immer neue Entdeckungen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 06.05.2021 3sat 34. Orgasmus – Das höchste der Gefühle
Folge 34Der Orgasmus wird mystifiziert, tabuisiert und von einigen niemals erreicht. Ein Orgasmus tut gut – aber warum? Was passiert im Körper beim sexuellen Höhepunkt, was hilft, wenn er ausbleibt? Vom neuronalen Feuerwerk in unserem Gehirn bis hin zu den evolutionsbiologischen Ursprüngen des Orgasmus-Reflexes bei weiblichen Säugetieren klären Wissenschaftler auf über Sinn und Wirkungskraft vom Orgasmus in unserem Körper. Wie häufig „kommen“ ist gesund? Orgasmen gelten als gesundheitsförderlich und sollen Krankheiten vorbeugen.Studien zeigen, dass sich bei Mann und Frau nach dem Orgasmus eine erhöhte Anzahl von Immunglobulinen in Blut und Speichel nachweisen lässt, zudem bewirkt das Hormon Oxytocin eine tiefere Entspannung, was die Regeneration des Körpers erhöht. Und umgekehrt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness, gesteigerter Erregbarkeit und häufigeren oder intensiveren Orgasmen? Prof. Frank Sommer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, hat sich auf Männergesundheit spezialisiert. Mit einem von ihm entwickelten Potenzmuskeltraining, bei dem unter anderem der Beckenboden trainiert wird, will er die Potenz und Orgasmen seiner Patienten steigern, „um langanhaltende Erektionen, eine längere Standfestigkeit und eine bessere Kontrolle über die Ejakulation zu erreichen“.Die Aufklärung der meisten Jugendlichen findet nicht in der Schule oder im Elternhaus, sondern beim Porno-Schauen im Internet statt. Diese Bilder bauen Leistungsdruck auf. Mit Folgen: Bis zu 30 Prozent der Männer zwischen 18 und 24 Jahren sind von sexuellen Dysfunktionen betroffen. Und Studien zufolge hat die Hälfte der Frauen bereits einen Höhepunkt vorgetäuscht. Während Männer so gut wie immer kommen, erleben den Klimax nur 65 Prozent der heterosexuellen Frauen. An der Universität Wien forscht die Evolutionsbiologin Prof. Mihaela Pavličev zum Sinn des weiblichen Orgasmus. „Einerseits ist er für den Fortpflanzungserfolg nicht erforderlich, und andererseits ist der Orgasmus-Reflex zu komplex, um bloß ein evolutionärer Unfall zu sein.“ Um diese Lücke im biologischen Wissen zu schließen, untersucht sie die Anatomie weiblicher Säugetiere. Die Erkenntnisse über die Entwicklung der weiblichen Geschlechtsteile könnten dabei helfen, die Ursachen für den „Orgasm-Gap“ zu entschlüsseln.Der Film zeigt neue Wege auf für einen offenen, ungezwungenen Umgang mit der schönsten und intensivsten Regung unseres Körpers. Betroffene berichten darüber, wie sie durch Unfälle, Krankheiten oder Krisen einen anderen Umgang mit dem Orgasmus erlernen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 10.06.2021 3sat 35. Talent oder Training? Die Wissenschaft vom Erfolg
Folge 35Maximaler Erfolg im Sport, beim Schach, beim Gesang oder Tanz – ist das richtige Training der Schlüssel zu Spitzenleistungen? Oder braucht man Talent? Und wenn ja: Wie definiert man Talent? Wissenschaftler*innen entschlüsseln nach und nach das Muster hinter Spitzenleistungen. Die Forschung zeigt: Mit dem richtigen Training kann man es sehr weit schaffen – aber die Kombination aus Talent und maßgeschneidertem Training ist nicht zu schlagen. Popstar oder Profifußballer*in werden oder als Tänzer*in über die großen Bühnen dieser Welt schweben, davon träumen Millionen von Menschen. Nur eine Handvoll erreichen diese Ziele.Sie sind eben Ausnahmetalente, haben das gewisse Etwas oder wurden mit einer fantastischen Stimme geboren, sind dann die tröstenden Worte. Ganz so einfach ist es nicht, sagt die Wissenschaft, allen voran der 2020 verstorbene Psychologe K. Anders Ericsson, der seine Kolleg*innen mit einer These aufrüttelte: Mit richtigem Üben kann jeder alles erreichen. Bestätigt hat diese These die dänische Psychologin Susanne Bargmann, die mit Ende 40 ein Popalbum herausbringt. Andere Forschungen haben gezeigt: In bestimmten Bereichen geht nichts ohne die genetische Veranlagung. Laut Tanzmedizinerin Eileen Wanke besteht Talent im Ballett aus einem flexiblen Körper und Rhythmusgefühl. Wer verkürzte Muskeln und Sehnen hat, hat keine Chance. Beim Klavierspiel helfen ein musikalisches Gehör und schnelle Finger. Brillante Schachspieler*innen zeichnen sich laut dem amerikanischen Neurowissenschaftler Alexander P. Burgoyne vor allem durch ihre kognitiven Fähigkeiten in Mathematik und Analyse aus. Dennoch wurden Hochtalentierte schon von weniger begabten Menschen überholt, die laut der Forscherin Laura Wesseldijk eine ganz bestimmte genetische Veranlagung hatten: die Motivation, oft und viel zu üben. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 12.08.2021 3sat 36. Mission Trinkwasser
Folge 36Durch Klimawandel, Landwirtschaft und Industrie drohen die natürlichen Frischwasserspeicher zu versiegen, versalzen und verschmutzen. Werden wir noch genug sauberes Trinkwasser haben? Nur 3,5 Prozent der Gesamtwassermenge der Erde sind Süßwasser. Das meiste ist jedoch als Eis gefroren. Nur 0,3 Prozent sind für uns Menschen zugänglich. Damit müssen wir lernen umzugehen. Die Natur als Vorbild, neue Technik und überliefertes Wissen machen Hoffnung. Wasserreserven aus der letzten Eiszeit, gespeichert im Meeresboden, könnten ein Hoffnungsschimmer für Europas wasserärmstes Land sein: Malta.Ein maltesisch-deutsches Forschungsteam analysiert mit elektromagnetischen Wellen den Meeresboden. Diese Technik könnte weltweit zum Einsatz kommen und trockenen, küstennahen Regionen zukünftig helfen. Noch steckt die Forschung in ihren Anfängen und prüft, ob eine nachhaltige Nutzung dieser Süßwasserblasen überhaupt möglich ist. Perus Wüstenhauptstadt Lima setzt auf überliefertes Wissen. Durch ihre genauen geologischen Kenntnisse konnten die frühen Andenkulturen die Berghänge als Wasserspeicher nutzen. Kann die geniale Technik Lima vor dem Durstkollaps retten? In Niedersachsen folgt der Film Deutschlands erstem Moor-Förster, Ludwig Stegink-Hindriks. Wie ein vollgesogener Schwamm besteht ein Hochmoor bis zu 90 Prozent aus Wasser. Statt Moore trocken zu legen und Regenwasser in Kanäle und somit ins Meer zu leiten, soll diese Speicherfähigkeit genutzt werden. Unweit des renaturierten Hochmoors wagt das Team von Nico Deus ein gewagtes Helikoptermanöver, um herauszufinden, wie weit das Meerwasser unterirdisch ins Land drückt. Denn steigende Meerwasserspiegel bedrohen weltweit und auch zunehmend in Deutschland durch Versalzung die küstennahen Grundwasserleiter. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 26.08.2021 3sat 37. Unter Druck: Wasserstoff in der Mobilität
Folge 37Einsteigen, Motor starten, losfahren – dank grünem Wasserstoff emissionsfrei. Der Rohstoff ist praktisch unbegrenzt vorhanden, lässt sich speichern und ist effizienter als Benzin oder Diesel. Das Problem: Wasserstoff-Autos sind teurer als Batterie-Autos. Es gibt noch zu wenig Tankstellen. Und die Erzeugung von grünem und damit klimaneutralem Wasserstoff ist teuer. Hat die Wasserstofftechnologie den Wettlauf um die grüne Mobilität bereits verloren? Vergleicht man die Zahlen, sieht es ganz danach aus: 2021 fahren über 300 000 Batterie-Autos auf deutschen Straßen. Dazu kommen rund eine Million Hybride. Aber gerade mal 808 Wasserstoff-Autos sind zugelassen.Bislang plant kein deutscher Autohersteller eine eigene Wasserstoff-Flotte. Doch den Vorteilen der reinen E-Mobilität stehen neben den Umweltproblemen der Batterieherstellung ganz andere pragmatische Verteilungsprobleme im Weg: Das deutsche Stromnetz ist derzeit nicht dafür ausgelegt, dass alle Verbrennungsmotoren von Batterieelektrischen Antrieben abgelöst werden. Grüne Mobilität ist also nicht die Entscheidung zwischen entweder E-Mobilität oder Wasserstoff-Mobilität, sondern muss die Frage beantworten, welche Energienutzung für welche Anwendung am sinnvollsten ist. Dabei zeichnet sich ab: Kurzstrecken mit geringen Lasten eignen sich für die E-Mobilität, die Langstrecke und Schwerlasten für den Wasserstoff-Antrieb. So fahren in der Schweiz bereits 45 Brennstoffzellen-Lkw. Bis Ende 2021 sollen es 1000 sein. Aber auch Wasserstoff-Verbrennungsmotoren sind in der Entwicklung. Seit 30 Jahren gilt Wasserstoff als Hoffnungsträger der Mobilitätswende. Und trotzdem hat sich bei Produktion, Distribution und Nutzung von grünem Wasserstoff nicht viel getan. Kann es gelingen, die Mobilität unserer Gesellschaft auf grünen Wasserstoff umzustellen – und welche Chancen und Risiken birgt das Multitalent der Energiewende? (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 02.09.2021 3sat 38. Wikipedia – Die Schwarmoffensive
Folge 38Wikipedia, 2001 gegründet, soll Wissen von allen für alle bereitstellen und wird als Online-Nachschlagewerk Nr. 1 genutzt. Zeit für eine kritische Bestandsaufnahme. Der Film greift zentrale Fragen rund um das Phänomen Wikipedia durch Begegnungen mit Protagonist*innen auf, die sich aus unterschiedlichen Motiven im Wikipedia-Kosmos engagieren oder ihm kritisch gegenüberstehen. 2001 von dem Amerikaner Jimmy Wales zusammen mit Freunden gestartet, hat Wikipedia das Prinzip der Autorenschaft revolutioniert.Jeder Artikel in Wikipedia wird von einem Autor (m/w/d) angelegt und von Hunderten anderer aus der ganzen Welt weiterentwickelt und fortgesetzt, korrigiert, kritisiert, teilweise gelöscht, komplett gelöscht und wieder neu geschrieben. Niemand wird vorher auf seine Qualifikation „geprüft“. Allerdings gibt es Standards, die eingehalten werden müssen. Und es gibt von der Wikimedia Foundation eingesetzte Administrator*innen und Stewards mit Eingriffsmöglichkeiten, falls diese Standards verletzt werden. Die Regisseurin Maria Teresa Curzio erklärt in ihrem Dokumentarfilm durch Gespräche mit Autor*innen und Wikipedia-Aktivist*innen wie Elke Koepping, Georg Hilt, Martin Rulsch und Peter Wuttke die Möglichkeiten und Grenzen von Wikipedia-Autor*innen und geht beispielhaft auf „Editierkriege“ ein. Außerdem beleuchtet sie mit dem Philosophen Thomas Metzinger und dem Wikipedia-Insider Pavel Richter auch kritisch, wie relevant die in Wikipedia eingestellten Inhalte in Bezug auf gesellschaftliche und menschliche Themen tatsächlich sind. Es ist bekannt, dass nur ein geringer Anteil der Wikipedia-Nutzer*innen auch Autor*innen sind und dass davon 85 Prozent weiß und männlich sind und in Ländern der westlichen Welt leben. Florence Devouard, seit Langem in der Wikipedia Foundation aktiv, hat mehrere Projekte initiiert, um Frauen zu unterstützen, selbst für die Wikipedia zu schreiben. Darunter auch eines in Afrika. Einen weiteren blinden Fleck der Wikipedia beleuchtet Curzio, indem sie den Peruaner Elwin Huaman begleitet, der eine Wikipedia-Version für seine indigene Gemeinschaft der Quechua bereitstellen will und auf Grenzen des Modells der Enzyklopädie stößt, dem die Wikipedia verpflichtet ist, aber einer Kultur oraler Wissensvermittlung nicht entspricht. Er will sich daher eines Bots bedienen, den der schwedische Programmierer Sverker Johansson für eine indigene Sprache auf den Philippinen entwickelt hat. Aber werden Bot-generierte Artikel von der Wikipedia-Gemeinschaft akzeptiert, und erfüllen sie die Standards? Diese Frage führt zu einer noch weitreichenderen: Wie wird Wissen in Zukunft überhaupt bereitgestellt? So gibt der Film auch Ausblicke auf die Themen des Zusammenspiels von Suchmaschinen und Wikidata – einer angestrebten abstrakten, das heißt, von natürlichen Sprachen unabhängigen Wikipedia – sowie von Chancen und Risiken einer personalisierten Wikipedia. Die Dokumentarfilmerin und Drehbuchautorin Maria Teresa Curzio stammt aus Uruguay und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Zu ihrem Film „Wikipedia – Die Schwarmoffensive“ schreibt sie: „Themen wie Wissen und authentische Information werden oft unterschätzt und manchmal erst wahrgenommen, wenn sie fehlen. Sie sind aber für eine funktionierende Demokratie ungeheuer wichtig. Ich bin in Uruguay während der Militärdiktatur aufgewachsen – unser Wissen wurde zensiert, kontrolliert und abweichende Meinungen unterdrückt. Freies Wissen war buchstäblich gefährlich. Das Nicht-wissen-können, aber auch das Nicht-wissen-wollen waren wichtige Säulen für den Machterhalt der Diktatur. Trotz aller problematischen Facetten steht Wikipedia für eine Idee, die mich bewegt: Wissen soll für alle verfügbar sein, und es soll sich ändern dürfen. In unserem Zusammenhang heißt das: Wie hat sich die Welt des Wissens von einem exklusiven Reservoir für nur wenige Herrschende zu einem wachsenden demokratischen Instrument für alle verändert? Wie kann sich die Gesellschaft mittels technologischer Fortschritte in Umgang mit Wissen weiterentwickeln? Und welche Gefahren stehen dahinter?“ (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 09.09.2021 3sat 39. Die Kraft der Klänge – Musik als Medizin
Folge 39Musik prägt uns schon im Mutterleib, berührt uns im tiefsten Inneren und kann zu Höchstleistungen treiben. Die Kraft der Klänge kann auch helfen, länger, gesünder und glücklicher zu leben. Musik wirkt auf allen Ebenen des Gehirns mit direktem Zugang zu unseren Emotionen. Das Geheimnis der Rhythmen und Melodien erforschen daher auch Neurowissenschaftler wie Peter Vuust und Stefan Kölsch, die Funktion und Entwicklung unseres Gehirns untersuchen. Musik helfe unserem Körper vielleicht besser als viele Medikamente, schon vorhandene Heilkräfte zu aktivieren, meint Stefan Kölsch von der Universität Bergen in Norwegen.Beim Kochen summen wir zu Popsongs aus dem Radio und schnippen im Takt, wenn ein besonders grooviger Song läuft. Peter Vuust vom „Center for Music in the Brain“ in Aarhus, Dänemark, hat das Geheimnis des Grooves erforscht und weiß, warum wir bei manchen Songs nicht mehr stillsitzen können. Die Dokumentation „Die KRaft der Klänge – Musik als Medizin“ untersucht den positiven Einfluss von Musik auf uns – vom Kleinkind bis zum älteren Menschen. Wenn ein Kind aus einem Albtraum erwacht, beruhigen wir es mit einem Schlaflied. Das nutzt auch Musiktherapeutin Friederike Haslbeck in der Neonatologie des Universitätsspitals Zürich. Sie summt für Frühgeborene, damit diese sich entspannen und so Energie schöpfen, um überhaupt zu wachsen. Vor allem Regionen im Gehirn, die die Kinder später für Motorik, Sprache und soziales Miteinander brauchen, entwickeln sich dank sanfter Stimulierung durch Musik besser. Beim Sport lassen wir uns von fetzigen Beats zu Hochleistung antreiben. Tom Fritz vom Max-Planck-Institut in Leipzig hat herausgefunden: Noch leistungsstärker werden wir, wenn wir die Musik beim Training selbst erzeugen. Wenn wir singen, sind wir miteinander verbunden – als Teil einer Gemeinschaft und gleichzeitig ganz bei uns. So singt auch Musiktherapeut Manuel Bannwart gern mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Demenzstation des Schweizer Altenheim Reusspark bei Zürich. Sandra Oppikofer vom Zentrum für Altersforschung der Universität Zürich hat dort in einer Studie mit den Bewohnern den Nutzen der Musik auch für die Pflege belegt. Diese gelingt mit Musik leichter, macht Patientinnen und Patienten sowie Pflegenden gleichermaßen mehr Spaß und senkt sogar den Einsatz von Medikamenten. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 15.09.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 16.09.2021 3sat 40. Selbstverliebt, machthungrig, kaltherzig: Unsere dunklen Seiten
Folge 40Manche Menschen haben hohe Anteile an selbstverliebten, machthungrigen oder kaltherzigen Eigenschaften. Das bedeutet jedoch nicht, dass Menschen dieser „Dunklen Triade“ immer „böse“ sind. Personen mit ausgeprägt dunklen Charaktereigenschaften haben oft auch eine besondere Ausstrahlungskraft, die wir anziehend finden. Doch sie können ihre Empathie bewusst an- und ausschalten und so andere für ihre Interessen manipulieren. Wie geht man mit ihnen um? Die Wissenschaft untersucht, wie sich dunkle Persönlichkeitszüge wie Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie entwickeln und auswirken.Laut der Studie des Psychologen Marcus Heidbrink ist Narzissmus in Führungsetagen weiter verbreitet als in der Gesamtbevölkerung. Welche Folgen das nach sich ziehen kann, weiß der Leadership-Coach Axel Nauert: „Dark Leader können ihre Mitarbeiter*innen derart terrorisieren, dass sie psychosomatische Krankheiten entwickeln, Depressionen bekommen und sogar an Suizid denken.“ Gerade Menschen mit hohen Anteilen an Selbstverliebtheit und Machthunger haben aber oft eine charismatische, anziehende Persönlichkeit – wenn sie jemanden von sich überzeugen wollen. Haben sie das Objekt ihrer Begierde erstmal um den Finger gewickelt, beginnt oft ein langer Leidensweg. „Mein narzisstischer Partner hat sich meiner Karrierechance in den Weg gestellt, mich von meinen Freunden isoliert und mir schließlich erfolgreich eingeredet, ich sei nichts wert“, erzählt Monika Celik. Die Amerikanerin M. E. Thomas wurde von einer Kommilitonin darauf angesprochen, ob sie Psychopathin sei. Mehrere Tests bei einem Psychiater bestätigten die Vermutung. Sie ist eine „erfolgreiche Psychopathin“ und schafft es, innerhalb der gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen zu leben. „Aber warum Menschen auf Beerdigungen weinen, verstehe ich bis heute nicht“, sagt sie. Der belgische Forscher Christian Keysers hat allerdings in einer Studie gezeigt: Menschen mit psychopathischen Zügen können durchaus die Gefühle anderer wahrnehmen – wenn sie es wollen.Zu erkennen, ob es im eigenen Umfeld Personen mit solch negativen Charaktereigenschaften gibt, ist notwendig dafür, sich ihrem Bann zu entziehen. Andererseits ist ein gesundes Maß an Selbstverliebtheit, Machtstreben oder Gefühlskälte wichtig, um in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren oder Höchstleistungen in vielen Bereichen zu erbringen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 30.09.2021 3sat 41. Rettet Felder und Gärten! – Pflanzen in Quarantäne
Folge 41Pflanzenschädlinge treten weltweit auf und bedrohen durch den globalen Handel zunehmend einheimische Äcker und Gärten. Konventionelle Schädlingsbekämpfung soll ferner eingeschränkt werden. Viele Viren, Bakterien und Pilze gefährden die Nahrungsmittelversorgung. Neue Sorten könnten helfen. Doch bevor sie zur Marktreife gelangen, sind viele Schädlinge mutiert. Kann die Wissenschaft den Wettlauf gewinnen? Der Klimawandel erhöht den Druck, zu handeln. „Dieser Pilz ist unbesiegbar“, sagt Biologe Adolf Kellermann von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.Er meint Phytophthora infestans, die Krautfäule – sie hat im 19. Jahrhundert für Millionen Hungertote in Europa gesorgt. Der Pilz ist noch immer eine existenzielle Bedrohung für viele Kartoffelproduzenten: Bei guten Witterungsbedingungen überträgt er sich schnell, infiziert ganze Äcker binnen kürzester Zeit und überdauert sogar in den Knollen unbemerkt viele Monate. Durch die Klimakrise nehmen solche und andere Pilzinfektionen weiter zu. Gelb- und Schwarzrost, sonst eher in Südeuropa heimisch, bedrohen hierzulande den Weizenanbau. Im bislang ersten Versuch dieser Art in Deutschland setzte ein Pflanzenzuchtunternehmen die „Gen-Schere“ CRISPR/Cas ein. Die genetisch veränderten Pflanzen zeigten innerhalb kürzester Zeit Abwehrkräfte gegen Pilze. Das Problem: Genom-editierter Weizen darf in Europa nicht im Freiland angebaut werden. Die allerersten Super-Weizenpflanzen warten nun im Gewächshaus bei Göttingen auf ihre Reise nach Nordamerika. 2016 befiel eine seltsame Krankheit die Mandelbäume auf Mallorca: Xylella fastidiosa, ein Bakterium. „Hätten wir gewusst, dass es aus den USA kommt und dort schon lange bekannt ist, man hätte etwas retten können“, meint Biologe Eduardo Moralejo. Aber nun sind praktisch alle Mandelbäume Mallorcas befallen und werden sterben. Xylella befällt auch Olivenbäume und sogar Zierpflanzen. In Hochsicherheitsgewächshäusern des Julius-Kühn-Instituts in Dossenheim züchten Forschende eingewanderte Schädlinge nach und analysieren Verbreitungswege und potenzielle Schäden. Ganz neu: das „Jordan-Virus“, das bisher vor allem Tomaten und Paprika in kommerziellen Kulturen befallen hat. Viren-Experte Heiko Ziebell warnt: „Verglichen mit dem Jordan-Virus ist das Corona-Virus ein Schwächling.“ (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 07.10.2021 3sat 42. Der Fluch des Gewinnens – Auktionen im Wettstreit
Folge 42Online ein Fahrrad ersteigern oder ein wertvolles Gemälde bei Sotheby’s – solche Auktionen sind bekannt. Auch Werbeplätze, Strom und Mobilfunkfrequenzen gehen nunmehr an die Höchstbietenden. Auktionen bewegen täglich Milliardenbeträge. Die klassische englische Auktion ist nur eine von vielen Formen der Versteigerung. Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson erhielten 2020 den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Forschung und Entwicklung neuer Auktionsformate. Die kleine Gemeinde Aalsmeer in den Niederlanden ist das Zentrum des globalen Blumenhandels.Bevor Tulpen, Rosen & Co.in alle Welt versandt werden, erhalten sie hier ihren Preis – mittels einer Versteigerung. Die „Holländische Auktion“ wurde genau zu diesem Zweck entwickelt. Anders als bei Kunstauktionen sinkt der Preis in Aalsmeer so lange, bis der oder die Erste zuschlägt. Die Auktion hat für die Händler*innen entscheidende Vorteile: Innerhalb von Sekunden entstehen Preise, die Angebot und Nachfrage entsprechen. Die moderne Wirtschaft ist durchdrungen von Auktionen. Auf dem Strommarkt und an der Börse funktioniert ohne sie gar nichts. Auktionen sorgen für Effizienz und Transparenz und sollen den Wettbewerb ankurbeln. Doch manchmal schießen sie über das Ziel hinaus. Die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen aus dem Jahr 2000 zeigt, was passieren kann, wenn eine Auktion aus dem Ruder läuft. Heute können Unternehmen ihre Mitarbeiter*innen in spieltheoretischen Beratungen speziell für Auktionen schulen lassen. Dort sollen sie lernen, wie man einer der größten Gefahren, dem „Fluch des Gewinners“ entgeht. Auch Fehler im Design von Auktionen können den Wettbewerb verzerren und die Beteiligten Millionen kosten. Wirtschaftswissenschaftler Prof. Axel Ockenfels von der Universität zu Köln beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Auktion als Marktwerkzeug. Er sagt: „Den Homo oeconomicus – den rein gewinnorientierten und rational handelnden Menschen – gibt es nicht. Wir brauchen Auktionsdesigns, die menschliche Regungen aushalten.“ In einer aktuell laufenden Studie testet Ockenfels ein neues Auktionsformat, das den Handel an der Börse revolutionieren könnte. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 14.10.2021 3sat 43. Strahlendes Comeback – Rettet Atomkraft das Klima?
Folge 43Manche Wissenschaftler*innen sehen in Atomkraft die Rettung für unser Klima. Entgeht Deutschland durch seinen Ausstieg aus der Kernenergie eine wichtige Zukunftstechnologie? Nach wie vor wird Strom in Deutschland überwiegend aus Kohle produziert. Trotz ihrer Vorreiterrolle bei der Energiewende ist die Bundesrepublik der größte Verursacher von CO2-Emissionen Europas. War der Atomausstieg in Anbetracht des Klimawandels ein Fehler? Die Eiskappen der Pole schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Trockenheit gefährdet immer mehr Ernten: Der Klimawandel schreitet ungebremst voran.Daher empfiehlt der Weltklimarat der Vereinten Nationen in einem Grundsatzpapier den Ausbau der Atomkraft. Während sich Deutschland jedoch von der Kernenergie abwendet, setzen andere Länder auf neue Reaktorkonzepte, die Unglaubliches versprechen: absolut sicheren, günstigen und CO2-freien Atomstrom für alle. Die Dokumentation „Strahlendes Comeback“ wagt den Tabubruch: eine offene Diskussion über das Für und Wider der Atomkraft vor dem Hintergrund des Klimawandels. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 04.11.2021 3sat 44. Generation Greta
Folge 44Noch nie war Widerstand so jung. Jugendliche, die mangels Wahlrechts keine Stimme in der Demokratie haben, machen mobil. Die „Generation Greta“ will die Welt verändern. Sie fordern Erwachsene auf, endlich Verantwortung zu übernehmen. Vier junge Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Bulgarien versuchen herauszufinden, wo die Konfliktlinien zwischen den Generationen verlaufen. Große Herausforderungen, die die Zukunft von jungen Menschen gefährden, müssen endlich angegangen werden: Klimakrise, Demokratiekrise, Systemkrise. Die Probleme, die Jugendlichen weltweit auf die Straße treiben, haben sich nicht geändert. „Die Hütte brennt immer noch, und es reicht nicht, sich ins Nebenzimmer zu flüchten“, wie Greta Thunberg einst sagte.Unabhängig von Corona und seinen Folgen bleiben die wichtigen Fragen: Wer ist „die Jugend“, und wie scharf ist die Trennlinie zur älteren Generation wirklich? Wird aus einer dezentralen Jugendbewegung die politische Stimme einer ganzen Generation mit Macht und Einfluss? Und wie gehen die jungen Menschen ganz individuell und persönlich damit um? Besitzt die „Generation Greta“ eine Kraft, die weit über die jeweiligen Landesgrenzen hinausreicht? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sprechen die vier Journalistinnen und Journalisten in ihren jeweiligen Ländern mit jungen Aktivistinnen und Aktivisten und begleiten sie bei ihren Aktionen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 11.11.2021 3sat 45. Body Positivity – Das neue Bild vom eigenen Körper
Folge 45Unser Aussehen bestimmt stark unser Selbstwertgefühl – oft nehmen wir unseren Körper negativer wahr als andere ihn sehen. Die Dokumentation ermutigt zu einem positiven eigenen Körperbild. Ob extra Pfunde, schiefe Zähne, auffällige Narben oder dünnes Haar – Menschen mit vermeintlichen Makeln werden häufig von Selbstzweifel und Scham geplagt. Sind wir von einem offenen Verständnis von Schönheit noch weit entfernt, während überall von Vielfalt geredet wird? Dabei sind Schönheitsideale von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Gebräunte Haut und dünne Körper gelten beispielsweise in vielen Ländern als Zeichen von Armut.Die Kosmetikfirma „Dove“ sorgte 2005 für Schlagzeilen, als sie mit ihrer „Initiative für wahre Schönheit“ erstmals „normale“ Frauen in ihre Werbespots integrierte – ohne Modelmaße. Noch immer bricht das Unternehmen mit den gängigen Schönheitsidealen und setzt auf „diversity“. Mittlerweile buchen immer mehr Firmen Models, die irgendwie anders sind – mit vermeintlichen Makeln. Sie wollen ihren Produkten mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Auch im Netz verzichten immer mehr Influencer*innen auf Bildbearbeitungsprogramme und setzen auf Natürlichkeit. Die Dokumentation „Body Positivity – Das neue Bild vom eigenen Körper“ geht weg von klassischen Idealen hin zu einem diversen Verständnis von Schönheit, bei dem die individuelle Einzigartigkeit in den Fokus gerückt wird. Sind das alles Vorboten eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbruchs – oder steckt dahinter nur ein neues Marketinginstrument? Der Autor Volker Wasmuth trifft Models mit Downsyndrom und Körperprothesen, begleitet eine Haartransplantation und lässt Expert*innen wie den Attraktivitätsforscher Prof. Lars Penke oder die „Diversity“-Spezialistin Anuschka Rees zu Wort kommen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 02.12.2021 3sat 46. Exponentielles Wachstum verstehen: Das Prinzip Seerose
Folge 46Von Corona bis Zinseszins: Exponentielles Wachstum bestimmt unser Leben. Es kann uns bereichern oder zerstören. Wir sollten es verstehen lernen – doch dazu ist unser Gehirn nur bedingt fähig. Eine exponentielle Kurvenentwicklung ist vielen Menschen wegen der Fallzahlentwicklung in der Coronapandemie ein Begriff. Dieses wahnsinnige Wachstum zu begreifen ist gar nicht so einfach. Wie können wir die große Beschleunigung besser verstehen und darauf reagieren? Wenn sich das Wachstum einer Seerose auf einem Teich jeden Tag verdoppelt und nach zehn Tagen der ganze Teich bedeckt ist, wann ist er zur Hälfte zugewachsen? Die Antwort: gerade erst am Tag zuvor, am neunten Tag – und nicht etwa zur Hälfte der Zeit, wie viele intuitiv erwarten würden.Höher, schneller, weiter – das Streben nach Mehr ist der entscheidende Faktor für menschliches Handeln. Das hat weitreichende Folgen für alle Lebewesen und Pflanzen, die auf der Erde leben und wachsen. Viele exponentielle Verläufe haben uns Wohlstand und Gesundheit gebracht. Andere – wie das Schmelzen der Gletscher – könnten unsere Existenz ernsthaft bedrohen, sollte es uns nicht gelingen, sie zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Eines der größten Probleme: Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, exponentielle Verläufe kognitiv zu verstehen. Unser Gehirn kann das einfach nicht. Woran das liegt, erklärt der Kognitionspsychologe und Wissenschaftsjournalist Christian Stöcker. Welche Methoden wir haben, die große Beschleunigung zu verstehen und sie in die richtige Bahn zu lenken, dazu befragt er zum Beispiel den Physiker und Epidemiologen Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 16.12.2021 3sat 47. Wundersaft Sperma – Ein Teelöffel Erbinformation
Folge 47Sperma – der Stoff, aus dem Leben entsteht. Das Ejakulat, ein Protein-Shake. Im Wundersaft tummeln sich bis zu 600 Millionen Samenzellen. Gut 1,5 Gigabyte an Erbinformation enthalten Spermien. Eigentlich reichen circa 30 Teelöffel der Samenflüssigkeit eines Mannes aus, um die gesamte Frauenwelt zu befruchten. Doch immer häufiger ist das Sperma nicht fit genug ist, um einen einzelnen Kinderwunsch zu erfüllen. Die milchig-klebrige Flüssigkeit wirft Fragen auf. Was ist da eigentlich drin? Warum wird die Qualität der Spermien immer schlechter? Kann man damit Geld verdienen? Männerärzte empfehlen, am besten mehrmals pro Woche Hand anzulegen – oder regelmäßigen Sex, denn nach zehn Tagen hat Sperma sein Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht.An der freien Luft überlebt es je nach Menge und Konsistenz wenige Minuten. Dafür werden aber in jeder Sekunde im Hoden etwa 1000 Spermien gebildet. Jede Stunde wandern etwa drei Millionen Spermien Richtung Nebenhoden, wo sie in rund 72 Tagen ausreifen. Die Spermatogenese bei Männern hört nie auf.Was die Größe der Spermien angeht, liegt die menschliche Spezies mit circa 57 bis 90 Mikrometern im Mittelfeld. Männliche Mäuse haben mit 124 Mikrometern die längsten Spermien im Säugetierreich, der Wal hingegen mit maximal 70 Mikrometern die kürzesten Spermien. Pro Höhepunkt stoßen Wale dafür mitunter eindrucksvolle 20 Liter Ejakulat aus.Mit gutem Sperma lässt sich gutes Geld verdienen: Single-Frauen mit Kinderwunsch, Regenbogenfamilien und unfruchtbare Hetero-Paare lassen sich von klassischen Samenbanken und Kinderwunschzentren helfen. Ein Alternative bieten private Spermabörsen, allerdings sind die medizinischen und juristischen Rahmenbedingungen zweifelhaft. Die 3sat-Wissenschaftsdoku „Wundersaft Sperma“ feiert den Saft des Lebens und räumt mit Mythen und Vorurteilen auf. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 13.01.2022 3sat 48. Die Eroberung der Weltmeere – Und die Macht der Wissenschaft
Folge 48Wem gehören die Weltmeere? Küstenstaaten kämpfen um Gebietsansprüche, denn der Meeresboden verspricht Rohstoffe. Über die Vergabe der Ozeangebiete soll die Wissenschaft entscheiden. Lange hatten die Ozeane keine Besitzer. Ein Zusatzartikel im UN-Seerechtsabkommen änderte dies 1994. Seitdem versuchen die Küstenstaaten, ein möglichst großes Meeresgebiet ihr Eigen zu nennen. Die Reichweite des Anspruchs hängt vom geologischen Festlandsockel ab. Je größer der geologische Festlandsockel eines Staates, desto größer ist auch das dazugehörige Meeresgebiet. Das Problem: Der Festlandsockel ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestimmen ihn durch geologische Messungen.In der Festlandsockelkommission der Vereinten Nationen bewerten 20 Geologen die von den Staaten eingereichten wissenschaftlichen Daten unter höchster Geheimhaltung. Allein mit ihren Entscheidungen verändern sich die Machtverhältnisse im Ozean – denn eine Kontrollinstanz gibt es nicht. Bereits 57 Prozent des Meeresbodens wurden so von den Küstenstaaten in Besitz genommen. Weltweit sind die Ozeane zu einem umkämpften Territorium geworden. Und der Erfindungsreichtum der Staaten kennt bei diesem Spiel keine Grenzen. Niemand kann abschätzen, welche ökologischen Folgen es haben wird, wenn die Staaten in ihre jeweiligen Tiefseegebiete vorrücken, um Rohstoffe aus dem Meeresboden zu gewinnen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 27.01.2022 3sat
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Wissen hoch 2 direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Wissen hoch 2 und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail