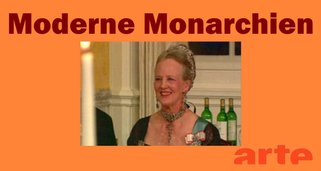4 Folgen
1. Dänemark
Folge 1 (52 Min.)Mit einem märchenhaften Akzent beginnt der Reihenauftakt Dänemark: Es war einmal … eine Frau mit 60 Jahren, die anders ist als andere Königinnen: Margrethe II, von Gottes Gnaden unter anderem Kostümdesignerin des königlich dänischen Balletts, Nachfahrin der Wikinger in nicht direkter Linie, verheiratet mit einem französischen Ex-Diplomaten und Mutter zweier properer Prinzen, von denen der eine, Frederik, ihr irgendwann auf den Thron folgen soll. Seit fast 30 Jahren regiert Margrethe II Dänemark, ohne je durch einen einzigen Skandal aufgefallen zu sein. Dänemark ist mit seiner mehr als tausendjährigen Geschichte die älteste Monarchie der Welt. Mehr denn je liegen die Dänen ihrer Königin zu Füßen – und das, obwohl sie Musterdemokraten sind.Der Auftaktfilm zur vierteiligen Reihe über die „Modernen Monarchien“ zeigt die wesentlichen Aspekte des dänischen Königshauses in einem vereinten Europa. Die Aktien stehen gut: Als Margrethe vor 28 Jahren den Thron bestieg, waren 40 Prozent der Dänen für die Republik und 42 Prozent für die Monarchie. Heute halten 97 Prozent die Amtsführung „Daisys“, wie sie in Anlehnung an das englische Wort für Margerite von jedermann genannt wird, für „hervorragend“ bis „sehr gut“. Und das, obwohl Margrethe ihren eigenen Weg geht, „Karelia ohne“ auf Kette raucht und eine leicht verruchte Note pflegt, ohne auf pompöse Bälle und auffällige Hüte zu verzichten. Den Dänen scheint gerade diese Mischung zu gefallen, was unter anderem dazu führt, dass die Mehrheit die Krone mehr liebt als den Euro. Zu Wort kommen Kritiker und Befürworter der dänischen Monarchie – vom Maler Thomas Kluge, der Margrethe völlig ungeschminkt mit den Falten einer 60-jährigen porträtierte und damit einmal mehr bewies, wie selbstsicher die Königin sich gibt, bis zum Kopenhagener Historiker und Monarchie-Gegner Benito Scocozza, der aus seiner Warte zu erklären versucht, warum sein aufgeklärtes Land so an seinem Oberhaupt hängt. Wie in jeder der vier Folgen kommen auch Jan van den Berghe, und Ines Imdahl zu Wort, die den Habitus der königlichen Familie analysieren und damit Fragen nach den Perspektiven für die Monarchie in Dänemark beantworten. Des weiteren trafen die Autoren die dänische Hofreporterin Merete Wilckenschildt sowie den Klatschreporter vom Kopenhagener Boulevardblatt Ekstrabladet, René Simmel, die aus dem Nähkästchen plaudern und ähnlich viel über die Monarchin und ihre Familie wissen wie der Hofkonditor und der königliche Blumenlieferant. Sie alle wissen, dass die Monarchie in Dänemark nur überleben kann, wenn sich Margrethes Thronfolger ein zukunftsträchtiges, eigenes Profil schafft, und wenn die „Marktanteile“ des Königshauses bei der Bevölkerung nicht sinken. Die Autoren André Schäfer und Andrew Davies haben sich in Dänemark und in den diversen Filmarchiven Europas gründlich umgesehen. Herausgekommen ist eine kritische Bestandsaufnahme einer ebenso schillernden wie anachronistischen Staatsform, die immer wieder eine Frage aufwirft: Ist da was faul im Staate Dänemark? (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Mi. 13.12.2000 arte 2. Spanien
Folge 2 (52 Min.)Keineswegs als Kurzgeschichte, jedoch durchaus kurzweilig widmet sich der zweite Teil der Reihe Spanien und seinem König: Juan Carlos de Borbon y Borbon, Alter: 62, Beruf: König. 25 Dienstjahre, Jahresgehalt ca. acht Millionen Dollar. Als er 1975 den Thron besteigt, nennt man ihn noch „el breve“, den „Kurzen“. Denn die Regierungszeit des damals scheinbar so farblosen jungen Mannes werde nur so kurz sein, wie ein Bonbon vor einer Schule liegt. Welch ein Irrtum! In einer Umfrage von 1997 bewerten über 80 Prozent aller Spanier die Arbeit von „El Rey“ als exzellent. Kaum ein anderer europäischer Monarch ist so beliebt und unumstritten wie er. Dabei hat kein Volk seine Könige so oft gestürzt wie die Spanier in ihrer fast 1.000 Jahre alten Monarchie.Bis 1975 wurde das Land fast 40 Jahre lang von einem Diktator mit eiserner Hand regiert, und als der junge Juan Carlos 1975 das Erbe seines „Ziehvaters“ Franco antritt, glauben alle an eine Fortsetzung der faschistischen Schreckensherrschaft. Doch der junge König denkt und handelt anders: Er führt sein Land nach langen Jahren des Leidens in die Demokratie. Recht schnell kommt der Prozess der „transición“ in Gang. Er wird noch einmal auf die Probe gestellt, als am 23. Februar 1981 Teile des Militärs das Parlament stürmen und die demokratische Regierung absetzen wollen. Nur das beherzte Eingreifen des Monarchen verhindert einen Rückfall in alte Zeiten. Der Beitrag zeigt die Geschichte der spanischen Monarchie im 20. Jahrhundert und die Rolle des Königs bei der Errichtung einer heute allgemein anerkannten Demokratie. Darauf aufbauend, fragt er nach den Überlebenschancen des Königshauses in der Zukunft. Beleuchtet werden dabei sowohl das alltägliche Arbeitsleben des Königs, seine Pflichten und Aufgaben, als auch das Privatleben in der Familie, die es immerhin schafft, ihre Mitglieder so weit wie möglich aus den Schlagzeilen der Regenbogenpresse herauszuhalten. Zu Wort kommen Menschen, die den König auf unterschiedliche Weise durch seine Amtszeit begleitet haben. Dazu gehört in erster Linie der ehemalige Chef des Königshauses Sabino Fernandez Campo, der so genannte „Schatten des Königs“, der ihn überallhin begleitete. Aber auch Journalisten unterschiedlicher Ausrichtung wie Lluis Bassets von der großen Tageszeitung „El Pais“ oder der „Hofreporter“ Jaime Peñafiel berichten von ihren Erlebnissen mit dem König und geben Einschätzungen darüber ab, warum der König bei seinem Volk so beliebt und anerkannt ist. Wie in allen vier Folgen sprechen auch hier Jan van den Berghe und Ines Imdahl aus ihrer kenntnisreichen Sicht über die Perspektiven des spanischen Könighauses. Die zum Verständnis der Voraussetzungen und Bedingungen der heutigen spanischen Monarchie wichtigen geschichtlichen Fakten verrät uns der Historiker und ausgewiesener Spanienkenner Dr. Walther Bernecker. Die Autorin Ulrike Brincker liefert mit ihrem Porträt des spanischen Königshauses eine kritische Bestandsaufnahme einer von vielen Mythen umgebenen Staatsform und stellt konkret die Frage nach Bedingungen und Zukunft der Monarchie in einem Land, das zum vereinten Europa des 21. Jahrhunderts unbedingt dazugehört. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Mi. 20.12.2000 arte 3. Liechtenstein
Folge 3 (52 Min.)An einen Wirtschaftskrimi oder ein Gesellschaftsspiel könnte man beim dritten Teil der Reihe denken. Der Erfinder von Monopoly muss sich eine Stadt wie Vaduz vorgestellt haben, als er sein Spielbrett entwarf: Klein, geordnet, unauffällig und mit jedem Feld ein bisschen teurer. „Rücke vor bis zur Schlossallee“ heißt es, und auf kaum jemanden trifft dies besser zu als auf den Fürsten von Liechtenstein, Hans-Adam II. Er regiert ein Wirtschaftsunternehmen, dass mit 32.000 Einwohnern den gesamten Staat umfasst.Der Fremdenverkehrsprospekt wirbt damit, dass man den Monarchen hier beim Einkaufsbummel treffen kann. Tatsächlich gibt sich der Fürst modern und volksnah, nicht nur am Staatsfeiertag, wo alle Liechtensteiner eingeladen sind, nach der Feldmesse im Schlossgarten ein Häppchen mit ihm zu essen. Überhaupt wäre er lieber Manager bei IBM geworden als Regent von Liechtenstein, einem kuriosen Staat, der nicht einmal halb so groß ist wie München, weder eine eigene Währung noch eine Armee, keine Universität, keine Autobahn, keine Gewerkschaften, dafür aber eine Fußball-Nationalmannschaft hat. Hier sind mehr als ein Drittel der Menschen Ausländer, und seit 1997 darf sich in Liechtenstein jeder EU-Bürger ohne Einschränkung niederlassen – mit allen steuerlichen Vorteilen. Das Vermögen, dass sich auf Liechtensteiner Treuhandkonten schlummernd vermehrt, wird auf 100 Milliarden Schweizer Franken geschätzt; und der Finanzsektor im Lande bringt weit mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen. 1995 gab es in Liechtenstein fünf Banken, 1999 waren es 13. Die Größte davon gehört dem Fürsten selbst. Dabei sah es in Liechtenstein nicht immer so rosig aus: Vor dem Ersten Weltkrieg, als Österreich noch Habsburg war, gab es nur Arbeiter und Bauern. Den Reichtum, darauf ist Hans-Adam II. besonders stolz, hat erst er geschaffen: „Ich muss vormittags Geld verdienen, um mir nachmittags leisten zu können, Fürst zu sein.“ Was das für Europa, für die Demokratie und für die Monarchie bedeutet, darüber gibt uns Durchlaucht Fürst Hans-Adam II. selbst Auskunft, ergänzt von Liechtensteins Regierungschef Mario Frick sowie dem Chefredakteur der fürstentreuen Tageszeitung „Liechtensteiner Vaterland“, Günther Fritz. Anders als sie gehört der Ex-Kabinettschef des Fürsten, Robert Allgäuer, heute zu den schärfsten Kritikern des Fürstenhauses. Neben dem Adelsexperten Jan van der Berghe und der Medienpsychologin Ines Imdahl vom Kölner Rheingold-Institut äußern ihre Meinung zu Staat, Fürst und Finanzplatz außerdem der Chef des Liechtensteiner EXPO-Pavillons Pio Schurti, Fachmann für die Kunst- und Kulturszene des Alpenstaates sowie der aus Köln zugereiste Chef des neuen Liechtensteiner Kunstmuseums, Friedrich Malsch. Unter anderem stellt er Teile der berühmten Sammlung des Fürsten aus. Denn der Grandseigneur sammelt, wie seine Vorfahren, italienische und niederländische Meister. Ganz nebenbei besitzt das Fürstenhaus daher eine der bedeutendsten Rubens-Sammlungen der Welt, die in der Dauerausstellung „Götter wandelten einst …“ zu bestaunen ist. Zur Zeit schwelt in Liechtenstein ein erbitterter Verfassungskonflikt: Fürst und Thronfolger wollen ihre Macht mindestens erhalten – immerhin ist neben Fürst Rainer von Monaco der Liechtensteiner Regent der Einzige in Europa, der wirklich politisch Macht ausübt. Institutionen wie Parlament und Opposition stören dabei natürlich. Daher bleibt spannend, wie sich das kleine Land und seine Monarchie in den nächsten Jahren entwickelt – oder ob es ganz von der Landkarte verschwindet. „Gehe nicht über Los. Ziehe nicht 4.000 Schweizer Franken ein“ – sollte dies das Fazit des kenntnisreichen Portraits von André Schäfer sein? (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Mi. 27.12.2000 arte 4. Belgien
Folge 4 (52 Min.)Wenn Baudouin – Gott hab ihn selig – des Nachts vom Himmel auf sein geliebtes Land blickt, sieht er es in hellem Lichte erstrahlt. Das kleine Königreich im Herzen Europas leistet sich den Luxus, seine Autobahnen komplett zu beleuchten. Doch so strahlend wie es von oben scheint, ist die Realität im krisengeschüttelten Land schon lange nicht mehr. Vom Sprachenstreit zwischen Flamen und Wallonen seit Jahrzehnten zermürbt, von Skandalen um Kinderschänder, dioxinverseuchten Hühnern und gepanschten Lebensmitteln zermürbt, wird Belgien als Idee fast ausschließlich vom Königshaus hochgehalten. Eigentlich seien die Belgier unregierbar, befanden schon die ersten Könige, die 1831 aus dem beschaulichen Sachsen-Coburg-Gotha ins Monarchen-Amt wechselten. Sie sahen ihre Aufgabe immer schon im Krisenmanagement. Bis heute hat sich daran nichts geändert.König Albert II. folgte 1993 überraschend seinem Bruder Baudouin auf den Thron, der das „Land der Fritten“ über vierzig Jahre lang pflichtbewusst und strenggläubig regierte. Albert, immerhin schon 59 Jahre alt, war ein erfahrener Lobbyist und stand an der Spitze von annähernd hundert Handelsmissionen. Trotzdem war er den Belgiern zunächst suspekt, denn anders als sein frommer und leidenschaftsloser Bruder machte der irdische Albert Schlagzeilen durch seinen lockeren Lebenswandel. Aber der heute in Belgien unumstrittene Monarch schaffte den Sprung vom Lebemann zur Autoritätsperson. Auch der Thronfolger – Sohn Phillipe – hat seit seiner Heirat mit der reizenden Mathilde an Ansehen gewonnen. Seitdem sehen auch die Belgier in dem ehemals geschmähten Prinzen jemanden, der das Land zusammenhalten kann. Der vierte Film aus der vierteiligen Reihe „Moderne Monarchien“ befasst sich mit der Rolle des Königs in einem krisengeschüttelten Land. Albert II. sei der einzige echte Belgier, wird immer wieder geschrieben. Er hat über allen Streitereien im Land zu stehen und muss immer wieder zur Einheit mahnen. Denn: Szenarien für die Auflösung Belgiens liegen in allen Politikerschubladen. Welche Zukunft hat also die belgische Monarchie? Sind der König und der Thronfolger dazu in der Lage, die Einheit im Land zu bewahren und Belgien sicher in das vereinte Europa des 21. Jahrhunderts zu führen? Zu Wort kommen Menschen, die König Albert II. sowie seinen Vorgänger Baudouin auf unterschiedlichste Weise begleitet haben. Wie Wilfried Martens, ehemaliger Premierminister, der zu Baudouins Zeiten insgesamt neun Regierungen führte. Während seiner Amtzeit war die Staatsreform eines der wichtigsten politischen Themen. Er gibt Auskunft über die Aufgabenbereiche des Königs sowie über Macht und Einfluss des Monarchen. Prof. Robert Senelle, Verfassungssachverständiger und Ex-Professor von Thronfolger Phillipe berichtet über die Rolle des Königs, seine Pflichten und Aufgaben. Christian Cannuyer, Historiker und Adelsexperte bietet einen Einblick in die Geschichte der jungen Dynastie und liefert Prognosen für deren Zukunft in Europa. Des weiteren äußern sich Journalisten der Zeitungen „De Morgen“, „Le Soir“ und „De Standaard“ zu den Qualitäten der königlichen Familie, deren Umgang mit der Presse, sowie Funktion und Stellenwert des Königs im dreisprachigen Land. Wie in allen vier Folgen beurteilen Jan van den Berghe, belgischer Adelsexperte und Fachmann für Klatsch und Tratsch sowie Ines Imdahl, Diplom-Psychologin vom Kölner Rheingold-Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen, die Perspektiven der belgischen Monarchie. Die Autorin Andrea Klüting porträtiert das belgische Königshaus und liefert eine kritische Bestandsaufnahme einer komplizierten Staatsform in einem auseinander driftenden Land, in dem es so schwierig ist, eine Einheit herzustellen. Dabei wird insbesondere der Frage nach der Zukunft der belgischen Monarchie im vereinten Europa nachgegangen. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Mi. 03.01.2001 arte
Erhalte Neuigkeiten zu Moderne Monarchien direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Moderne Monarchien und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.