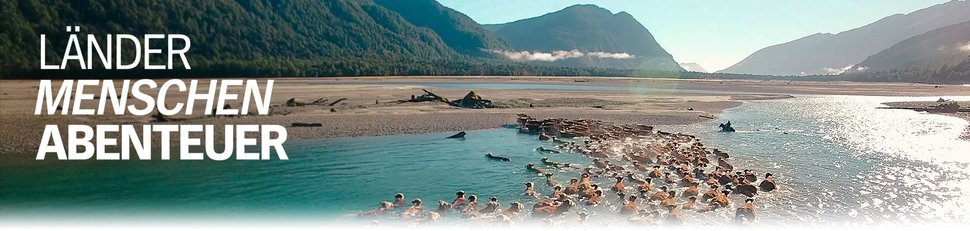1783 Folgen erfasst, Seite 51
Prinzeninseln
Nahe der Bosporusmetropole Istanbul, zwischen Europa und Asien, liegt ein Archipel von neun Eilanden: die so genannten „Prinzeninseln“. Einst wurden missliebige byzantinische Prinzen aus ihrem prachtvollen Palast in Konstantinopel hierhin verbannt. Inzwischen gilt die Inselgruppe im Marmara-meer als Oase. Mehrmals täglich legt eine Fähre in Istanbul ab und erreicht nach etwa einer Stunde das erste der vier großen Eilande: Kinali. Es folgen Burgaz, Heybeli und Büyük Ada, jeweils 14 bis 20 km vom Festland entfernt. Nahezu unbewohnt sind die fünf kleinen Eilande. (Text: BR Fernsehen)Eine Prinzessin auf dem Urubamba – Das Versorgungsschiff der Machiguengas
Deutsche TV-Premiere Sa. 11.09.1982 S3 von Elvira und Heinz-Günther HiltropDie Prinzessinnen von Rajasthan – Die ungewöhnlichen Frauen der Wüste Thar
Bis auf 50 Grad Celsius kann die Temperatur in der Wüste Thar im indischen Bundesstaat Rajasthan steigen. Und dennoch leben Menschen in dieser unwirtlichen Region. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht das traditionelle Dorfleben, so etwa hat das Volk der Bishnoi eine ganz besondere Beziehung zu seiner Umwelt entwickelt. Vor allem die Frauen machen sich um die Pflege der Kultur und der Gebräuche verdient. Die Wüste Thar liegt im indischen Bundesstaat Rajasthan an der Grenze zu Pakistan. Sie zählt zu den heißesten und trockensten Regionen der Erde.Temperaturen über 50 Grad Celsius sind hier keine Seltenheit. Neben ausgedehnten Sanddünen sind nur gelegentlich etwas Gestrüpp oder ein paar dürre Grashalme zu entdecken. Die wenigen Orte, in denen die Menschen der Wüste Thar leben, verfügen über keinerlei Komfort. Es gibt kein fließendes Wasser und elektrischen Strom höchstens für ein paar Stunden am Tag. Inmitten dieser lebensfeindlichen Umwelt leben – in seltsamem Kontrast – anmutige und stolze Frauen in strahlend bunten Gewändern. Sie sind von so einer natürlichen Eleganz und Schönheit, dass sie auch die „Prinzessinnen von Rajasthan“ genannt werden. Diese Frauen tragen die Hauptlast bei der alltäglichen Arbeit und der Erziehung der Kinder, kümmern sich um den Bau der Lehmhäuser und deren kunstvolle Verzierung und bereiten die täglichen Mahlzeiten zu. Nur die Pflege der Tiere ist Aufgabe der Männer. Bei all ihren Verrichtungen wirken die Frauen stets gelassen und geben ihre Werte und Tugenden auch voller Überzeugung an ihre Töchter und Söhne weiter. Filmemacher Peter Weinert und sein Team haben mehrere Dörfer im Westen des indischen Bundesstaates Rajasthan besucht, in dem rund ein Drittel seiner Bevölkerung lebt. Mit faszinierenden Aufnahmen zeichnet Peter Weinert in seiner Dokumentation ein Porträt der trockenen Wüstenlandschaft und ihrer Bewohner. Sein besonderes Augenmerk richtet sich auf die ungewöhnlichen Frauen der Wüste Thar, ihre Lebensbedingungen und ihre Traditionen. (Text: BR Fernsehen) Procida
Ischia und Capri im Golf von Neapel sind weltberühmt. Capri als Trauminsel für Exzentriker, die Reichen und die Schönen aus der ganzen Welt. Wegen der heißen Quellen ist Ischia zu einem Mekka für Wellnessapostel und Rheumapatienten geworden. Die Nachbarinsel Procida ist dagegen eher weniger bekannt. Zudem war Procida lange Zeit berüchtigt – als Gefängnisinsel. Nachdem im 19. Jahrhundert die Festung auf dem Felsen hundert Meter hoch über dem Meer in einen ausbruchsicheren Kerker umgewandelt wurde, bezeichnete man Procida als „Alcatraz Italiens“. Das Gefängnis wurde – nach langen Kämpfen einer Bürgerinitiative – 1988 geschlossen.Dabei gilt Procida seit den 60er Jahren als Geheimtipp: Menschen, die abseits des Massentourismus, die ursprüngliche wilde Schönheit Italiens suchen, reisen auf diese Insel. Die meisten Einheimischen wollen diese Ursprünglichkeit bewahren und ein Leben führen, das immer noch von der Natur, dem Meer und der Kirche bestimmt wird. Die Religiosität der Menschen dieser Insel findet ihren Höhepunkt in der berühmten Prozession in der Karwoche. Procida – ein knapp vier Quadratkilometer großer Buckel im Mittelmeer, mit der Fähre nicht mehr als eine Stunde von Neapel entfernt, ein Ort, an dem die Zeit – wie es scheint – stehen geblieben ist. (Text: BR Fernsehen) Projekt Angkor Wat – Rettung einer Tempelstadt
Seit zwölf Jahren zieht es die Geologen Hans und Esther Leisen, die auch als Steinrestauratoren am Kölner Dom arbeiten, regelmäßig in ein geheimnisvolles Gebiet am Rande des kambodschanischen Dschungels. Unter schwierigen Klima- und Arbeitsbedingungen sind sie angetreten, gemeinsam mit einem kambodschanischen Team, das größte sakrale Bauwerk der Erde zu retten – die über zwei Quadratkilometer große Tempelanlage von Angkor Wat. Die Konservierung der weltberühmten Flachreliefs und der himmlischen Tänzerinnen, aber auch die Rekonstruktion der Tempelarchitektur per Computer oder die Übersetzungen der Inschriften durch andere Wissenschaftler, sind Versuche, die einzigartige Kultur Angkors zu erhalten und besser zu verstehen. Doch die Arbeit von Professor Leisen und seiner Frau ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn die Verwitterung im feucht-heißen Klima Kambodschas schreitet unerbittlich voran. Von den Erfolgen und Rückschlägen in diesem scheinbar endlosen Kampf erzählt dieser Film. (Text: WDR)Die Provence – Frankreichs leuchtender Süden
Die Provence im Südosten Frankreichs ist für viele Menschen einer der Sehnsuchtsorte überhaupt: romantische Bergdörfer, lila blühende Lavendelfelder, türkisblaue Meeresbuchten, das alles erhellt vom milden Licht des Südens. Diese Kombination hat seit jeher Maler, Literaten und Lebenskünstler in die Region zwischen Rhonetal und Italien gelockt. Und Abenteurer: Denn inmitten der Provence befindet sich die größte Canyonschlucht Europas: die Gorges du Verdon. Auf einer Länge von 21 Kilometern und bis zu 700 Meter tief bietet sie Abenteuer und Herausforderungen in aller Vielfalt.Ganz unten rauscht der namensgebende Fluss Verdon, durch dessen Wildwasser sich Extremsportler auf kleinen Hydrospeedbrettern wagen. Ohne ortskundige Führer wie Jean Phillipe kann der Nervenkitzel lebensgefährlich werden. Doch auch er und sein Team müssen zu Beginn der Saison die Strecke immer neu erkunden, bevor sie hier Ungeübte ins Wasser lassen. Denn der Parcours ändert sich: Ständig stürzen Felsbrocken oder Bäume in den Fluss und schaffen stetig neue Hindernisse, Stromschnellen und Grotten. Wenn Wildwasserpaddler, Hochseilartisten oder Bergwanderer verunglücken, dann kommt die Spezialeinheit zur Bergrettung (GRIMP) der Feuerwehr zum Einsatz. Die speziell ausgebildeten Höhenretter können selbst in 400 Meter hohen Steilwänden Menschenleben retten. Ihren Einsatz müssen die Männer um Colonel Dossolin regelmäßig üben, damit es im Ernstfall schnell geht, auch wenn die Sicherheit Vorrang hat. Bei einer Übung wird der Nachwuchsfeuerwehrmann Anthony Isnard 30 Meter in eine Steilwand herab gelassen, um von den Kollegen gerettet zu werden. Unter ihm, 360 Meter tief, liegt die atemberaubende Verdonschlucht. Einer der Hauptwirtschaftszweige für die Menschen in der Provence ist das Geschäft mit dem Lavendel. Viele traditionsreiche Familienbetriebe produzieren hier Öle, Seifen und Essenzen für die legendären Parfümhersteller von Grasse. Odile Tassi versucht in Clansayes, einem kleinen Dorf in der nördlichen Provence, ihren Traum zu verwirklichen: eine eigene Lavendelproduktion in Bioqualität. Daraus möchte sie selber Kosmetikartikel herstellen. Dafür hat sie ihren gut bezahlten Job als Businessfrau aufgegeben. Allerdings stößt sie auf jede Menge Widerstände: Der knallrote Klatschmohn breitet sich in Windeseile in ihren Feldern aus und verkrautet ihre Lavendelpflanzen. Odile muss vieles mühsam in Handarbeit erledigen. Und ihr alter Peugeot-Trecker Baujahr 1976 will auch nicht immer. Darüber hinaus begegnen ihr auch noch viele alteingesessene Bauern mürrisch und missgünstig. Der Sport der Provence ist Boule, das Spiel mit kleinen polierten Stahlkugeln, das hier überall auf den von Platanen gesäumten Dorfplätzen von Jung und Alt zelebriert wird. Die Boules werden in Marseille noch in Handarbeit gefertigt. Im Familienbetrieb der Rofritschs fertigt Stammhalter Hervé mit wenigen Angestellten die „Boules Bleues“ in vierter Generation. Jedes Muster wird von Hand gefräst, jede Kugel im alten Ofen gebrannt und einzeln poliert. Hervé glaubt, dass nur so wirkliche Qualität entsteht. Allerdings setzt die Konkurrenz auf computeroptimierte Prozesse und verkauft aus diesem Grunde viel mehr Boulekugeln. (Text: NDR) Der pünktlichste Zug der Welt – Unterwegs mit dem Shinkansen (1) – Von Tokio zum japanischen Meer
45 Min.Japans Shinkansen, ein Zug der Rekorde: Er gehört zu den schnellsten Zügen der Welt. Außerdem fährt der stylische Express seit mehr als 50 Jahren unfallfrei. Und der Shinkansen ist mit Abstand der pünktlichste Langstreckenzug der Welt. Teil 1 des Zweiteilers „Der pünktlichste Zug der Welt …“ erkundet Japans neueste Shinkansen-Strecke: Es geht aus der Hauptstadt Tokio nach Kanazawa, Zentrum des japanischen Traditionshandwerks. Vor der Abfahrt in Tokio wird der Shinkansen von Keiko Higuchi und ihrem wohl ebenso schnellsten Putzteam der Welt in Rekordzeit auf Hochglanz gebracht. Die 31-jährige Haruka Kato ist eine der wenigen Frauen, die den Rekordzug lenken.Ihr Zug verlässt Tokio an diesem Tag mit 1:15 Minuten Verspätung. Eine Katastrophe! Während Kato im Cockpit hochkonzentriert daran arbeitet, trotzdem auf die Sekunde pünktlich im Zielbahnhof einzufahren, genießt Fake-Food-Künstlerin Noriko Seko im Fahrgastabteil die atemberaubende Landschaft der Japanischen Alpen. Die kunstvoll gestalteten Essensnachbildungen stehen in allen japanischen Restaurants im Schaufenster als dreidimensionale Speisekarte. In Kanazawa wird sie ihr neuestes Kunstwerk, einen Plastikaal auf Plastikreis, einem Kunden überreichen. Auf dem Weg quer durch die Hauptinsel Japans fährt der Shinkansen an einigen der schönsten und ursprünglichsten Orte des Landes entlang. Bauern kultivieren hier den Wasabi-Meerrettich, eine äußerst anspruchsvolle Pflanze. Das grün gefärbte Wasabi zum Sushi in Deutschland hat mit dem echten aus Japan wenig gemein. Das Original hat eine ganz andere Dimension, was Schärfe und Aroma betrifft. Japans beste Holzschnitzer, Spezialisten für die aufwendigen Ornamente buddhistischer Tempel, schnitzen auch schon mal E-Gitarren in Drachenform. Bis die größten Taiko-Trommeln der Welt in einer jahrhundertealten Manufaktur ihren markerschütternden Beat erklingen lassen, vergehen zuweilen Jahre. Doch Japan wäre nicht Japan, wenn nicht gleich neben Traditionsbetrieben und Tempeln auch an ultramoderner Technik gearbeitet würde. Shinkansen-Ingenieure gewähren einen seltenen Blick in ihre Hightechwerkstatt, eine Testfahrt mit dem Shinkansen der Zukunft. An der Endstation wird es wieder sehr traditionell. Eine Geisha lüftet ein kleines bisschen den Schleier über den geheimnisvollen Ritualen ihrer Unterhaltungskunst. Eine Entdeckungsreise mit dem Superzug in das Zentrum japanischer Tradition und Handwerkskunst. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 09.06.2022 NDR Der pünktlichste Zug der Welt – Unterwegs mit dem Shinkansen (2) – Von Osaka in den Süden Japans
45 Min.Japans Shinkansen: ein Hightechzug der Rekorde, seit mehr als 50 Jahren unfallfrei und mit Abstand der pünktlichste Langstreckenexpress der Welt. Einer der schnellsten Züge ist er auch. Und der sauberste. An Höflichkeit ist das Personal schwer zu überbieten. Der Sanyo Shinkansen verbindet die beiden größten Städte im Südwesten des Landes miteinander: Osaka und Fukuoka auf der Halbinsel Kyushu. Während die Fahrgäste atemberaubende Landschaften bestaunen, ist Schaffner Yasuhiro Umeoka dafür zuständig, dass es ihnen an nichts fehlt. Das gelingt ihm auch besonders gut, er wurde als bester Kundenbetreuer ausgezeichnet.Rennrad-Fan Tomoya Hoshi ist auf dem Weg zu einer der spektakulärsten Radstrecken der Welt, dem Shimanami Kaido. 60 Kilometer fast nur über Brücken, die kleine Inseln des japanischen Inlandmeeres verbinden, und das exklusiv für Radler. Nächster Halt: Hiroshima. Die Stadt, in der die erste Atombombe der Welt fiel. Eine junge Generation hält gemeinsam mit den letzten Überlebenden dieser Urkatastrophe des Atomzeitalters die Erinnerung wach. Auf der Route liegt auch Shimonoseki, die Welthauptstadt des extrem giftigen Kugelfisches. Nur hochspezialisierte Experten dürfen ihn zubereiten. Ein Fugu-Koch wählt auf der nächtlichen Auktion die richtigen Exemplare aus und zeigt, wie die Locals ihre geliebte, aber potenziell tödliche Delikatesse am liebsten verspeisen. Yumiko Takino ist Sängerin einer populären Girlgroup. Ein großer Star, der japanische Jugendliche in Hysterie versetzt, und ein großer Shinkansen-Fan. Sie macht sich auf die Suche nach „Doctor Yellow“, dem knallgelben und äußerst seltenen Inspektionszug, der die Strecke des Shinkansen prüft. Wer „Doctor Yellow“ trifft, dem ist das Schicksal wohlgesonnen, sagt man in Japan. Für Trainspotter ist dieser gelbe Zug wie die Blaue Mauritius für Briefmarkensammler. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 09.06.2022 NDR Puerto Rico – Sonne, Sand und Salsa
Alte spanische Kolonialarchitektur neben modernen Wolkenkratzern, urige Tapasbars neben schicken Fast-Food-Shops, rustikale Paradores neben amerikanischen Luxushotels: Puerto Rico verbindet wie keine andere Insel karibisches Flair und spanisches Temperament mit amerikanischer Lebensart. Diese kleinste der Großen Antillen gehört seit über hundert Jahren politisch zu den USA; die Puertoricaner sind amerikanische Staatsbürger, aber ihre Mentalität ist eine Mischung aus indianischem Erbe und jenem der spanischen Conquistadores. Bevor Puerto Rico an die Amerikaner fiel, war die Insel spanische Kolonie.Spanisch ist auch die Landessprache. Nirgends erlebt man die karibisch-spanische Mischung intensiver als in der Hauptstadt San Juan. Hier Viejo San Juan mit seiner farbenprächtigen Kolonialarchitektur, dort die Skyline der Neustadt Condado und das Bankenviertel Hato Rey – die Filmautorin Ingeborg Koch-Haag schaut sich ausführlich um in der Stadt, taucht ein in die Szene. Überall auf der Insel, aus jedem Laden, aus jedem Auto dröhnt Salsa – was ist das eigentlich, wie lernt man diesen Tanz? Ingeborg Koch-Haag besucht Kunsthandwerker, die religiöse Figuren schnitzen oder Furcht erregende Masken, sie trifft Indianer bei der Pflege alter Traditionen, lässt sich zeigen, was es mit der Pina Colada auf sich hat, die hier erfunden wurde, und woher der Rum stammt. Urlauber schätzen vor allem die Landschaft – die feinen Sandstrände im Norden, wo die Karibik rauscht, die schroffen Felsen an der Atlantikseite im Süden. Der einzige Regenwald der US-Nationalparks kann auf Puerto Rico besucht werden – und Mangrovendickichte am frühen Morgen, in der Begleitung einheimischer Fischer. Doch vor allem bezaubert die Lebensart und Heiterkeit dieses Vielvölkergemisches (Text: hr-fernsehen) Puerto Rico – Wo Salsa den Rhythmus bestimmt
- Arbeitstitel: Puerto Rico - Leben im Rhythmus der Karibik
45 Min.Sandstrand vor der Tür, abenteuerlicher Regenwald, überraschende Leckerbissen und über allem Salsa: Das ist Puerto Rico. Salsa hat auf der Karibikinsel das ganze Jahr Saison, der Rhythmus ist so etwas wie die Nationalhymne des Landes. Kaum zu glauben, aber auch das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Im sogenannten Außengebiet der USA leben seine knapp drei Millionen Menschen auf der kleinsten Insel der Großen Antillen. Nicht alle Boricuas, wie sich die Inselbewohner selber nennen, wären gern Amerikaner. Sie genießen das Leben in der Karibik und stellen sich den Widrigkeiten des Lebens unerschrocken und kreativ.Jacky Ramos ist der weibliche „Ricky Martin von Puerto Rico“: talentiert, populär, schillernd. Die Salsa-Tänzerin lebt den Traum vieler Puerto Ricanerinnen. Ihr größter Erfolg: der dritte Platz bei einer Weltmeisterschaft. Mittlerweile steht sie weniger selbst auf der Bühne, sie unterrichtet mehr. Mit ihren Nachwuchstalenten trainiert sie vor Publikum am Strand oder in einem Salsa-Salon in der Altstadt. „Sinnliches Bewegen, das ist Salsa“, sagt Jacky. Die Jugend zählt ebenso zu ihren Fans wie die ehemalige Miss Puerto Rico, Windy. Jacky bereitet sie auf ihren ersten Auftritt vor Fachpublikum vor. Tanya Martinez’ Arbeitsplatz ist dort, wo Puerto Rico abgeschieden und abenteuerlich ist, im immergrünen Regenwald im Zentrum der Karibikinsel. Hier sorgt sie sich um den Erhalt einer auf Puerto Rico einmaligen Papageienart. Hurrikan Maria vernichtete den Lebensraum der Tiere beinahe vollständig. Heute vermehren sich die überwiegend grünen Vögel mit türkisfarbenen Flügelspitzen wieder. Arianna Font Martin ist ein kleiner Star in Puerto Rico und eine Art Gegenmodell zum Auswanderungstrend. Anstatt ihre Heimat zu verlassen, versucht sie, die Lebensqualität ihrer Landsleute zu verbessern. Gemeinsam mit Omar Negron hat die Studierende ein mobiles Filtersystem entwickelt, mit dem sich verschmutztes Wasser einfach aufbereiten und trinken lässt. Zugang zu sauberem Wasser ist keine Selbstverständlichkeit in Puerto Rico. Hurrikans und Überschwemmungen belasten die Infrastruktur besonders auf dem Land. Mehr als 12.000 Menschen haben Arianna und ihr kleines Team bereits zu sauberem Trinkwasser verholfen. (Text: NDR) Die Pyrenäen: Bären und Influencer
45 Min.Die Welt der Pyrenäen ist faszinierend. Die Berge haben das Salz der Meere in sich und den Honig der Akazien, den Geruch des Schnees und den der Lilien. Die Pyrenäen sind mehr als nur ein Gebirge. Eine Landschaft voller Geheimnisse, in der man sich verliert, ohne verloren zu gehen. Atlantik oder Mittelmeer, hinter jedem Gipfel liegt das Meer – und ein neuer Horizont. Die Menschen hier erfinden sich gerade neu. Entschleunigung, Respekt vor der Natur und nachhaltiges Wirtschaften stehen ganz oben auf ihrer Agenda. Sie sind Wissenschaftler, Hirten, Winzer und Bärenbeschützer. Die erste Folge beginnt am Cap de Creus, wo die Pyrenäen wellenumspült an der katalonischen Küste aus dem Mittelmeer auftauchen. Hier springen jedes Jahr bis zu 1000 Frauen und Männer ins offene Meer und schwimmen bis nach Cadaqués. In den hohen Bergen von Andorra sucht ein Apnoetaucher sein Glück in klaren Bergseen. Und weiter westlich breitet sich in einsamen Tälern eine noch kleine Population von Braunbären aus. (Text: NDR)Die Pyrenäen: Unter Sternen und Schafen
45 Min.Die Welt der Pyrenäen ist faszinierend. Die Berge haben das Salz der Meere in sich und den Honig der Akazien, den Geruch des Schnees und den der Lilien. Die Pyrenäen sind mehr als nur ein Gebirge. Eine Landschaft voller Geheimnisse, in der man sich verliert, ohne verloren zu gehen. Atlantik oder Mittelmeer, hinter jedem Gipfel liegt das Meer – und ein neuer Horizont. Die Menschen hier erfinden sich gerade neu. Entschleunigung, Respekt vor der Natur und nachhaltiges Wirtschaften stehen ganz oben auf ihrer Agenda.Sie sind Wissenschaftler, Hirten, Winzer und Bärenbeschützer. Die zweite Folge führt in die französischen Hochpyrenäen und zu den Sternen über dem Pic du Midi. Von hier aus ist die Weite des Universums gleichermaßen sichtbar wie jene allerhöchsten Gipfel der Pyrenäen. Weiter unten wacht über die Schafherden der Patou, ein riesiger weißer Hund mit sanftem Blick, der es mit Wölfen und Bären aufnimmt. Auf dem Monte Perdidio besucht der Geologe Nacho López mit seiner Expedition einen der letzten Gletscher des Gebirges. (Text: NDR) Das Rätsel von Nevali Cori – Steinzeit-Kultur am Euphrat
Deutsche TV-Premiere Mi. 15.04.1992 S3 von Manfred Linke und Elke WerryRagnar Stefansson – Bergbauer am grössten Gletscher Europas
Deutsche TV-Premiere Sa. 14.05.1983 S3 von Georg FeiglRapa Nui – die Osterinsel
Um 350 nach Christus besiedelten Polynesier auf der Suche nach Neuland Rapa Nui, die Osterinsel. 3.700 Kilometer vom südamerikanischen Festland und 2.250 Kilometer von der nächsten bewohnten Insel entfernt, entwickelten sie ihre Kultur ohne Kontakt mit der Außenwelt, bis die Europäer das Eiland entdeckten. – Ein Film über die Geschichte der Osterinsel und ihrer Bewohner. (Text: 3sat)Raubkatzen
Raubkatzen beeindrucken die Menschen seit den kulturgeschichtlichen Anfängen. Unsere Vorfahren glaubten bei ihnen noch an übernatürliche Kräfte. (Text: BR Fernsehen)Rauch über Alantika – In den vergessenen Dörfern Kameruns
Die vergessenen Dörfer im Alantika-Gebirge in Kamerun direkt an der Grenze zu Nigeria liegen so weit abseits der Täler, dass noch nicht einmal Missionare hierher gefunden haben. Nach einem anstrengenden Fußmarsch über zweieinhalb Tage bei Temperaturen von bis zu fünfzig Grad im Schatten erreichte das Fernsehteam des Hessischen Rundfunks das Bergdorf Bimlerou. Etwa 15 Familien vom Stamme der Koma leben hier in ihren Lehmhütten. Niemand weiß, woher die Koma gekommen sind. Etwa 10 000 sollen in Kamerun leben.Der so genannte Fortschritt hat diese Menschen bisher nicht erreicht. In der Abgeschlossenheit geben ihnen Sittengesetze und strenge Lebensregeln einen festen Halt. Ihre Abhängigkeit von der Natur schuf eine tiefe Frömmigkeit. Die Frauen tragen ihr traditionelles Kleid, das aus Sträuchern hergestellt wird, jeden Tag neu. Die Koma sind Jäger und Sammler, bauen aber auch Hirse und Gewürze an. Aus der Asche von verbranntem Gras filtern sie Salz. Zu ihren Festen brauen sie Hirsebier. Die Frauen sind Pfeifenraucher, auch der Tabak wird selbst angebaut. Fremdartige Gebräuche erlebte das hr-Team bei den Koma. Nach wie vor werden den verheirateten Frauen die oberen Schneidezähne entfernt, weil sie nur mit dieser Zahnlücke imstande seien, Kinder zu gebären. Im hohen Norden Kameruns, in den Mandara-Bergen, lebt seit etwa 400 Jahren ein anderes kleines Volk, das Volk der Podoko. Das Oberhaupt der 25 Dörfer mit insgesamt 20 000 Einwohnern, eines malerischer als das andere, ist König Mozogo. Er hat fünfzig Frauen und über hundert Kinder. (Text: hr-fernsehen) Die Regenmacher – Bei den Bulsa und Tallensi in Ghana
Deutsche TV-Premiere Mi. 15.11.1995 S3 von Monika KovacsicsRegentätowierung – In den Pfahlbauten der Mentawaier
Blutegel, Schlammflöhe und Regen waren die ständigen Begleiter des hr-Filmteams von Peter Weinert während der Dreharbeiten bei einer Stammesgruppe der Mentawaier auf Siberut, der größten Insel des Mentawai-Archipels. Siberut liegt etwa 140 Kilometer westlich der indonesischen Hauptinsel Sumatra. Die Insel ist fast völlig mit tropischem Regenwald bedeckt, und die einzigen Fortbewegungsmittel sind Einbäume. Während der Regenzeit können Flüsse innerhalb weniger Stunden um bis zu fünf Meter ansteigen und ein ganzes Tal in einen See verwandeln. Rituale und Zeremonien bestimmen auch heute noch das Leben der Mentawaier, die vor etwa 2.000 Jahren mit der Besiedlung Siberuts begonnen haben. Hauptnahrungsmittel dieses Naturvolkes ist das Sagomehl, das aus der Sago-Palme gewonnen wird. Dem Filmteam ist es gelungen, auch die schmerzhafte Zeremonie der Tätowierung, der sich Männer wie auch Frauen unterwerfen, zu dokumentieren. Bis die Ganzkörpertätowierung abgeschlossen ist, vergehen mehrere Jahre. (Text: hr-fernsehen)Reiche Nachbarn am Golf – Kuwait, Katar, Bahrain
Die kleinsten Staaten der Arabischen Halbinsel könnten kaum unterschiedlicher sein: Katar, das reichste Land der Welt, gilt als konservativ und traditionsbewusst. Bahrain wiederum ist weltoffen und liberal. Und Kuwait gilt als besonders ursprünglich. Kuwait, Katar und Bahrain – die kleinsten Staaten der Arabischen Halbinsel könnten kaum unterschiedlicher sein: Das marmorverzierte Katar, das reichste Land der Welt, gilt als konservativ und traditionsbewusst. Bahrain wiederum ist weltoffen und liberal, hier gibt es Religionsfreiheit, Bars und Nachtleben. Sogar uneingeschränkter Alkoholausschank ist erlaubt. Und Kuwait gilt als besonders ursprünglich, aber weltoffen.Die Menschen hier lieben gutes Essen, teure Autos und schnelle Kamele. Ghanima al Freh ist sich sicher: Kuwait hat das beste Essen auf der Arabischen Halbinsel zu bieten. Ghanima muss es wissen, sie ist Chefin eines traditionellen Restaurants und hat schon in allen Nachbarländern gekocht. Ihr Restaurant in Kuwait-Stadt ist berühmt. Denn Ghanima beschäftigt ausschließlich Frauen und zu ihr kommt hauptsächlich weibliche Kundschaft. Einmal im Jahr ist in der Wüste Bahrains die Hölle los: Dann beginnt die viermonatige Campingsaison. Die Menschen in Bahrain lieben es, ihr Wochenende in der Wüste in Zeltlagern zu verbringen. Und Abu Ahmed hat dann jede Menge zu tun. Er vermietet vier Zeltlager und muss alles in Schuss bevor die Gäste anreisen. Die arabische Kultur hat viele Regeln und Bräuche. Hamad al Amari hat daraus ein Geschäftsmodell entwickelt: Er gibt Kurse in arabischen Benimmregeln für Ausländer. Darin übt er mit ihnen den traditionellen Nasenkuss und das korrekte Anlegen des arabischen Gewandes. Für Omran ist ein wichtiger Tag: Seine Schwerttanz-Gruppe tritt bei einer großen Hochzeit auf. Omran ist Arda-Lehrer und bringt dem Nachwuchs bei, wie man das Schwert zur Trommelmusik schwingt. Auf der Hochzeit müssen die Kleinen nun beweisen, was sie gelernt haben. (Text: BR Fernsehen) Die reichen Armen von Corvo – Auf der kleinsten Insel der Azoren
Deutsche TV-Premiere Sa. 16.01.1982 S3 von Walter BittermannReichlich Wasser vor der Hütte – Im Herzen einer Luxusinsel
„Blumen des Indischen Ozeans“ nannte Marco Polo die Inselkette entlang des Äquators. Die Malediven mit ihren unzähligen Atollen gelten mit als schönste Plätze der Welt, vor allem für Taucher. Nur rund 200 der insgesamt 1 195 Inseln sind bewohnt, 87 davon sind für Touristen zugänglich. Doch „auf einer solchen maledivischen Insel hätte nicht einmal ein Robinson Crusoe überleben können. Außer Sand und Palmen gab es dort nichts. Heute ist das 200 Meter lange und 150 Meter breite Eiland Vabbinfaru ein kleines, aber eigenständiges Paradies. Um den Luxus-Urlaubern aber dieses perfekte Bild bieten zu können, bedarf es einer ganz eigenen Logistik. Mitten im Zentrum der Insel schlägt – für die Gäste unsichtbar – das künstliche Herz des Ressorts: Maschinenräume, Stromgeneratoren, Großküchen, Lager- und Kühlräume, Trinkwasser- und Müllverbrennungsanlagen. (Text: BR Fernsehen)Reinhold Messner in der Mongolei – Bei den Tuwa-Nomaden
Wie macht man Milchschnaps? Wie baut man eine Jurte auf? Wie fängt man ein wildes Fohlen ein? Hautnah erleben der Abenteurer Reinhold Messner und sein 14-jähriger Sohn Simon den Alltag der Nomaden in der Mongolei. Die beiden Tiroler sind, begleitet von einem Kamera-Team, in den Hohen Altai gereist, in das Land von Dschingis Khan. Dort, im unzugänglichen Westen der Mongolei, nahe der Grenze zu China, leben die Tuwa, ein rund 4.000 Mitglieder starker Nomaden-Stamm, der mit Pferden, Yaks, Schafen und Ziegen ganzjährig durch die Steppe zieht. Reinhold und Simon Messner sind einer persönlichen Einladung gefolgt: Sie sind Gäste von Galsan Tschinag, dem Stammesführer der Tuwa. Tschinag ist nicht nur Nomadenchef, sondern auch Schriftsteller.Zudem spricht und schreibt er deutsch, denn studiert hat der heute 62-Jährige in Leipzig in der ehemaligen DDR. In seinen Büchern erzählt er von den Mythen und Traditionen seines Volkes. Die Tuwa wurden einst von der Sowjetunion zwangsumgesiedelt und von Galsan Tschinag 1995 wieder in ihr Stammland zurückgeführt. 2.000 Kilometer legten sie damals zurück; ihre Karawane zurück in die Heimat sorgte international für Aufsehen. Heute führen sie im Altaigebirge ein hartes, aber autarkes Leben. Sie ernähren sich vom Fleisch und der Milch ihrer Tiere und stellen Erzeugnisse aus Wolle, Filz, Leder und Fell her. Sie sprechen eine eigene Sprache und konnten sich ihre schamanistische Religion über die kommunistische Zeit hin bewahren. (Text: hr-fernsehen) Deutsche TV-Premiere So. 29.01.2006 Südwest Fernsehen von Elke WerryEine Reise durch Estland – Von Tallinn zur Insel Muhu
2001 hat Estland als erstes osteuropäisches Land den Eurovision Song Contest gewonnen. Am 25. Mai 2002 fand dieser in der Hauptstadt Tallinn statt. Für die Esten ist das kein Zufall. Musik ist für sie fast so wichtig wie die Ostsee. Wie aber sieht Estland aus, und wer sind seine Bewohner? Der 39-jährige Villu Veski stammt von einer kleinen Insel vor Estlands Küste. Als Musiker ging er an die Musikakademie in Tallinn, wo er heute mit seiner Familie lebt. Villu Veski ist einer von drei Komponisten, die eine Showeinlage für das Schlagerfinale gestalteten.Für das Jahr 2002 hatte er sich etwas Besonderes vorgenommen: Er wollte auf seiner Heimatinsel in der Ostsee das Musikfestival „JuuJääb“ veranstalten – zur Halbzeit des langen, dunklen estnischen Winters. Die Vorbereitungen führten ihn auf eine Reise quer durch das wald- und seenreiche Estland. Villu besuchte seinen Freund, den Bierbrauer, um für das Fest das starke, süße Muhu-Bier zu brauen. Er musste ein Schwein am Grill organisieren, er lud Tanzkapellen ein, und er ließ eigens ein nagelneues Klavier aus Tallinn herbeischaffen. Zwischendurch entspannte sich Villu bei typisch estnischen Freizeitvergnügungen: Er war zur Fuchsjagd eingeladen und besuchte die Rauchsauna. Nur 1,5 Millionen Menschen bewohnen den nördlichsten der baltischen Staaten, der 1991 unabhängig wurde und einen weitgehend unbekannten Winkel Europas darstellt. Mit aller Macht versuchen sich die Esten vom Ostblockimage zu befreien, hin zu Skandinavien, hin zu Europa. (Text: hr-fernsehen) Eine Reise durch Pommern
Pommern – jahrzehntelang war die einst preußische Provinz durch den Eisernen Vorhang in fast unerreichbare Ferne gerückt. Zwei Millionen Deutsche lebten bis Ende des Zweiten Weltkrieges in Hinterpommern, zwischen Stettin und dem Flüsschen Piasnitz an der Grenze zu Westpreußen. Sie mussten ihre Heimat 1945 verlassen; dort wurden Polen angesiedelt, Menschen, die ihre Heimat ebenfalls verloren hatten, denn ein großer Teil Ostpolens wurde Weißrussland zugeschlagen. Aus Pommern wurde Pomorze. Nach einer langen Zeit des Argwohns wächst nun auf beiden Seiten der Oder das Interesse an guter Nachbarschaft. Die Reise von Stettin nach Danzig zeigt die polnische Gegenwart, aber auch die Zukunftshoffnungen und die Zukunftsängste der hier lebenden Menschen.So berichten etwa Fischer und Kleinbauern über ihre Sorge, im europäischen Wettbewerb nicht mehr mithalten zu können. Junge Polen, Kaufleute und selbstständige Handwerker sehen in der zukünftigen EU-Mitgliedschaft aber eher wirtschaftliche Vorteile. Die Dokumentation erinnert aber auch an das Pommern von einst: an ein Land mit romantischen Alleen, sattgrünen Wiesen, auf denen Störche Mäuse und Frösche jagen, jahrhundertealten Backsteinkirchen und einem unendlich weiten Horizont über riesigen Feldern. (Text: hr-fernsehen)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.