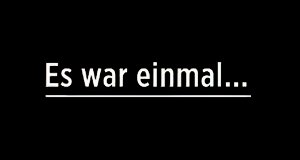bisher 31 Folgen, Folge 17–31
17. Get – Der Prozess der Viviane Amsalem
Folge 17 (51 Min.)Der Film „Get – Der Prozess der Viviane Amsalem“ aus dem Jahr 2014 bildet den Abschluss der Familientrilogie von Ronit und Shlomi Elkabetz. Schon im ersten Film „Getrennte Wege“ sehnt sich Viviane danach, ein neues Leben zu beginnen und ihren Mann Elisha zu verlassen. Im Anschluss an den zweiten Film „Shiva“ beschreibt der letzte Teil mit kafkaesker Genauigkeit den unermüdlichen Gerichtsmarathon, den Viviane Amsalem erdulden muss, um ihre Scheidung durchzusetzen. Er spiegelt so das Leben vieler Frauen wider, die zwischen Tradition und Freiheitsdrang hin- und hergerissen sind.Denn auch zwei Jahre nach dem Erscheinen des Films ist es in Israel für verheiratete Frauen nicht leicht, ihre Unabhängigkeit zurückzuerlangen. Scheidungen und Hochzeiten werden ausschließlich religiös geschlossen, die Zivilehe gibt es nicht. Und selbst wenn der rabbinische Gerichtshof der Scheidung zustimmt, tritt diese erst mit der Einverständniserklärung des Ehemanns in Kraft. Fehlt dieser „Get“ genannte Scheidungsbrief, bleibt die Frau an ihren Gatten gekettet die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen, wird ihr verwehrt. Viviane Amsalem ist eine dieser „Agunot“, dieser Angeketteten. Die packende Handlung beschränkt sich fast ausschließlich auf die Gerichtsräume und zeigt die Entwicklung des Prozesses in seinem ganzen Ausmaß. Ronit Elkabetz will einen Anstoß geben: „Wir müssen der Sache heute in die Augen schauen. Und uns muss klar sein, dass sich hier etwas ändern muss.“ Der Film prangert den Missstand schonungslos an und würdigt den mutigen Widerstand der Frauen, mit dem diese der verzweifelten Lage zu entrinnen versuchen. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Di. 29.11.2016 arte 18. Mommy
Folge 18 (52 Min.)„Mommy“ ist der fünfte Film von Xavier Dolan aus dem französischsprachigen Kanada und erzählt von der verwitweten Diane, die vor lauter Hilflosigkeit mit dem Gedanken spielt, ihren hyperaktiven und aggressiven Sohn Steve in eine psychiatrische Anstalt einzuweisen. Ihre komplizierte Beziehung reflektiert stellvertretend die Schwachstellen der kanadischen Gesellschaft; darunter die Verarmung der Mittelschicht, das Zerbrechen des klassischen Familienmodells und die brutalen Methoden der psychiatrischen Anstalten. „Mommy“ bescherte dem damals gerade 25-jährigen Xavier Dolan gewissermaßen den Adelsbrief: den Sonderpreis der Jury bei den Filmfestspielen in Cannes 2014. Anschließend wurde das Drama in der ganzen Welt ausgezeichnet und machte den jungen Kritikerliebling endlich auch beim breiten Publikum bekannt.„Es war einmal … Mommy“ von Tessa Louise-Salomé und Serge July entstand in Montréal in Zusammenarbeit mit Xavier Dolan und seinen Schauspielern. Er ist der 42. Film der Reihe „Un film et son époque“ von Serge July und Marie Genin. Die Dokumentation zeigt am Beispiel von „Mommy“, wie Xavier Dolan seine Filme schreibt und realisiert. Sie schildert die sorgfältigen Drehvorbereitungen, die enge Zusammenarbeit mit den Schauspielern und die aufmerksame Kontrolle der gesamten Produktion. Sie fragt auch danach, warum Xavier Dolan in Zeiten von Internet und Technik, von Hollywood-Blockbustern, Modezeitschriften, Popmusik und Fernsehserien nicht nur ein außergewöhnlicher Filmemacher ist, sondern auch eine Generation vertritt, für die der Mix von Genres und Kulturen alltäglich geworden ist. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere So. 14.05.2017 arte 19. The Queen
Folge 19 (52 Min.)Der Film „Die Queen“ (2006) des britischen Regisseurs Stephen Frears stellt sich mutig der Aufarbeitung jüngster britischen Geschichte: den kurzen, aber heftigen Konflikt zwischen dem jungen britischen Premierminister Tony Blair und der Queen nach dem tödlichen Unfall von Prinzessin Diana im Jahr 1997. Weil die Queen befand, dass Diana nach ihrer Scheidung von Prinz Charles nicht mehr zur königlichen Familie gehöre, wollte sie weder das Begräbnis ausrichten noch eine offizielle Erklärung zu Dianas Tod abgeben. Die kühle, distanzierte Haltung der Monarchin, die in starkem Kontrast zur heftigen Trauer der britischen Bevölkerung stand, löste Wut und Fassungslosigkeit aus.Darüber geriet sogar die Monarchie, eine der Säulen des politischen Systems in Großbritannien, ins Wanken. Tony Blair hatte den Ernst der Lage erfasst. Mit großem Geschick gelang es ihm, die Queen umzustimmen und ein Staatsbegräbnis ausrichten zu lassen. Die Dokumentation „Es war einmal … The Queen“, hebt hervor, wie gewagt Frears Film war. Lebende Mitglieder der königlichen Familie in einem Film zu zeigen, war bis dato ein absolutes Tabu gewesen. Stephen Frears, der von der dokumentarischen, sozialkritischen Free-Cinema-Bewegung der 50er Jahre geprägt ist, beschreibt, wie er sich an ein nationales Monument heranwagte. „Die Queen“ ist ein realistisches, zutiefst menschliches Porträt der britischen Königin, großartig dargestellt von Helen Mirren. In der Dokumentation schildert die Schauspielerin, wie sie sich auf die Rolle vorbereitete und wie es ihr gelang, dass die Grenzen zwischen Darstellerin und Monarchin verschwammen für diese eindrucksvolle Leistung wurde sie mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Dokumentation zeigt auch, dass sich Frears und sein Drehbuchautor Peter Morgan trotz der gründlichen dokumentarischen Arbeit und der authentischen Archivbilder auch große künstlerische Freiheiten nahmen. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere So. 23.07.2017 arte 20. Wall Street
Folge 20 (52 Min.)„Wall Street“ von Oliver Stone kam 1987 in die Kinos. Es war Stones fünfter Spielfilm und die erste Fiktion, die auf derart detaillierte Weise die Hochfinanz während der großen Deregulierung der Reagan-Ära unter die Lupe nahm. „Wall Street“ erzählt vom Aufstieg und Fall des Bud Fox, eines der sogenannten Golden Boys, die ehrgeizig, zynisch und zu allem bereit waren, um immer mehr Geld zu scheffeln. Bud Fox stellt sich in den Dienst des Wall-Street-Spekulanten Gordon Gekko, einem Ausbund an Skrupellosigkeit. Doch das Abenteuer, auf das er sich damit einlässt, wird böse enden.In seinem Dokumentarfilm „Es war einmal … Wall Street“ zeigt Filmemacher Rémi Lainé, welch akribische Recherchearbeit Oliver Stone und sein Drehbuchautor Stanley Weiser im New Yorker Börsenmilieu betrieben und welche real existierenden Personen, die damals für Schlagzeilen sorgten und nicht selten vor Gericht landeten, ihnen als Vorbild dienten. Außerdem erklärt die Dokumentation, dass Stone mit „Wall Street“, unmittelbar nach dem oscargekrönten Erfolg von „Platoon“, eine Hommage an seinen verstorbenen Vater drehte, einem Broker, dem Loyalität und Gemeinwohl noch etwas bedeutete. Unter anderem anhand bislang unveröffentlichter Interviews mit Oliver Stone und Michael Douglas wird die ungewöhnliche Geschichte des Films erzählt, der heute längst als Klassiker gilt. Die schonungslose Darstellung der Mechanismen, die in den 80er Jahren die Finanzindustrie zu bestimmen begannen, hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Heute erscheint sie wie ein Warnsignal für die wiederholten Krisen, die dieses System ausgelöst hat, sei es der Börsenkrach im Oktober 1987 unmittelbar vor dem Kinostart von „Wall Street“ oder die Subprime-Krise von 2008. Vor allem aber zeigt die Dokumentation, wie Stone, der eigentlich die skrupellosen Finanzhaie anprangern wollte, mit seinem Film ungewollt genau das Gegenteil erreichte: Der habgierige Gordon Gekko wurde zum Vorbild für Generationen von Tradern, Bankern und Investoren, und seine berühmte Rede über die Vorzüge der Gier („Greed is good“ „Gier ist gut“) wurde Wort für Wort von US-Präsident Donald Trump übernommen. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere So. 05.11.2017 arte 21. Mustang
Folge 21 (51 Min.)„Mustang“ ist der erste Spielfilm der türkisch-französischen Regisseurin Deniz Gamze Ergüven, der nach einer viel beachteten Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2015 mehrfach ausgezeichnet und vom internationalen Publikum gefeiert wurde. Das poetische Märchen erzählt mal komisch, mal dramatisch vom Aufbegehren fünf junger Schwestern gegen die erdrückende patriarchale Ordnung in einem kleinen Dorf am Schwarzen Meer und beleuchtet so das Schicksal zahlreicher Frauen in der heutigen Türkei, deren Leben von männlicher Dominanz, Zwangsheirat und sexualisierter Gewalt geprägt ist. Einziger Ausweg: die Flucht aus dem Joch von Familie oder Ehe.Weltweit haben sich etliche Frauen in der Geschichte wiedererkannt. „Es war einmal … Mustang“ schildert anhand von Interviews und aktuellen Aufnahmen die Entstehungsgeschichte des mutigen Spielfilmdebüts, vom Verfassen des Skripts in Paris über die Dreharbeiten mit den fünf jungen Laiendarstellerinnen am Schwarzen Meer bis hin zum turbulenten Filmstart in der Türkei. Die Dokumentation geht auch auf die Demonstrationen von 2013 im Gezi-Park ein, bei denen sich zahlreiche Gegner des islamisch-konservativen Erdogan-Regimes versammelten: Ergüven erklärt, welche Anspielungen auf die Protestbewegung in ihrem Film versteckt sind. So verbirgt sich hinter der scheinbar leichten Geschichte von „Mustang“ ein sehr politisch engagierter Film, der die tiefe Spaltung eines Landes sichtbar macht, in dem Tradition, Patriarchat und Religion von modernen, säkularen und liberalen Bestrebungen erschüttert werden. Seit dem gescheiterten Putschversuch von 2016 verstärkt sich dieser Bruch durch das Abdriften der Türkei in ein autoritäres System, das ganz offen Frauenrechte und bürgerliche Freiheiten angreift. Darüber hinaus spiegelt sich in „Mustang“ eine Zerrissenheit wider, die Deniz Gamze Ergüven als Tochter zweier Kulturen am eigenen Leib erfahren hat. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Mi. 16.05.2018 arte 22. Loveless
Folge 22 (52 Min.)„Loveless“ ist der fünfte Spielfilm des russischen Filmemachers Andrei Swjaginzew. Boris, leitender Angestellter, und Schenja, die in Moskau einen Friseursalon betreibt, stecken mitten in der Scheidung. Ihr zwölfjähriger Sohn Aljoscha fühlt sich ungewollt und ungeliebt. Schweigsam erträgt er die heftigen Auseinandersetzungen seiner Eltern, bis er eines Tages auf dem Rückweg von der Schule verschwindet. Eine Gruppe freiwilliger Helfer begibt sich auf die Suche nach ihm.“Es war einmal … Loveless“ zeichnet ein sehr realitätsnahes Porträt des russischen Mittelstandes unter Putin, in „Loveless“ verkörpert vom Ehepaar Boris und Schenja.Sie sind konsumorientiert und selbstbezogen. Die Dokumentation wurde in den Kulissen des Spielfilms im russischen Winter gedreht und vermittelt die seelenlose Anonymität der gigantischen Wohnsiedlungen am Stadtrand von Moskau; hier sind die Spuren der Sowjetära omnipräsent. „Loveless“ kritisiert auch den Staat und die Polizei, die sich nicht um Vermisste kümmern. Die Suche nach ihnen wird gänzlich von der Freiwilligenorganisation „Lisa Alert“ übernommen.Im Interview betonen mehrere ihrer Aktivisten, die in „Loveless“ als Laiendarsteller sich selbst spielen, die zivilgesellschaftliche Bedeutung ihres Engagements. Zu Wort kommen ferner die Hauptdarsteller des Films, der Produzent, der Kameramann und Andrei Swjaginzew selbst. Der 1964 in Sibirien geborene Regisseur zählt zu den führenden Vertretern des neuen russischen Films. Seine von Cannes bis Venedig prämierten Filme haben in Russland mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. „Leviathan“, sein vorletzter Film, wurde wegen der scharfen Kritik an der allgegenwärtigen Korruption heftig angegriffen und zensiert. Auch mit seinem in „Loveless“ gezeichneten Porträt der russischen Gesellschaft geriet Swjaginzew ins Kreuzfeuer der Kritik – ein erneuter Beweis, dass der Kampf um die Freiheit der Kunst in Russland noch lange nicht ausgefochten ist. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Mi. 13.05.2020 arte 23. „The Square“
Folge 23 (52 Min.)Der Kurator eines Museums für zeitgenössische Kunst in Stockholm präsentiert seine neueste Installation: „The Square“ ist ein großes weißes Quadrat auf dem Boden vor dem Museum, das für Vertrauen und Altruismus stehen soll. Doch am Tag vor der Einweihung werden dem Kurator Geldbörse und Handy gestohlen. Bei der Suche nach dem Mobilgerät wirft er seine gutmenschlichen Prinzipien schnell über den Haufen. Außerdem startet sein Marketingteam eine Werbekampagne, die so skandalös ist, dass sie ihn zum Rücktritt zwingt. Allmählich wird ihm bewusst, wie oberflächlich und leer sein Leben wirklich ist.Die Dokumentation beleuchtet Entstehung, Kontext und Produktion von Ruben Östlunds viertem Spielfilm, der 2017 bei den Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme erhielt. Filmausschnitte, exklusives Drehmaterial und andere Dokumente zeigen, dass „The Square“ auf Erlebtem basiert, denn der Filmemacher stellte die gleiche Installation als eine Art soziales Experiment in einem schwedischen Museum aus. Schonungslos macht er sich über die zeitgenössische Kunst lustig, wenn sie so abstrakt ist, dass sie ans Abstruse grenzt, und vor allem wenn sie sich blind den Gesetzen des Viralmarketings unterwirft. Deutlich wird auch Östlunds Kritik an der schwedischen Gesellschaft: Das Land, einst Vorreiter der skandinavischen Sozialdemokratie, hat heute mit Individualismus und sozialer Ungleichheit zu kämpfen. Ruben Östlund ist der bekannteste Vertreter des schwedischen Filmnachwuchses. Die Dokumentation zeigt ihn als anspruchsvollen Profi, der seine Schauspieler bei langen Plansequenzen zuweilen überstrapaziert, um das Beste aus ihnen herauszuholen, und als scharfen Beobachter der gesellschaftlichen Verhältnisse, in dessen Arbeiten die Frage des Altruismus eine zentrale Rolle spielt. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Mo. 18.05.2020 arte Deutsche Streaming-Premiere Mo. 18.05.2020 arte.tv 24. Ich, Daniel Blake
Folge 24 (52 Min.)Zwischen absurden Amtsentscheiden und hoffnungslosen Bewerbungsversuchen: Daniel Blake lebt als Witwer im nordöstlichen Newcastle upon Tyne und erleidet kurz vor der Rente einen Herzinfarkt, der ihn als Zimmermann arbeitsunfähig macht. Da er stets ins Sozialsystem eingezahlt hat und seinen Pflichten als Bürger nachgekommen ist, erhofft er sich in dieser schweren Zeit finanzielle Unterstützung vom Staat und beantragt Sozialhilfe.Doch sein Antrag wird abgelehnt und er erhält auch nach mehrmaligem Nachfragen keine eindeutige Begründung für den negativen Bescheid.In der zuständigen Behörde rät man ihm, Arbeitslosenhilfe zu beantragen und sich in der Zwischenzeit um einen neuen Job zu bemühen. Daniel hat nicht nur mit dem zermürbenden Bürokratieapparat und dessen Intransparenz zu kämpfen, sondern auch mit der fortschreitenden Digitalisierung des immer komplexer werdenden Arbeitsmarktes.Eines Tages, erneut mit Anträgen und Formularen des Jobcenters kämpfend, lernt er die alleinerziehende Mutter Katie kennen, die ebenfalls an der fehlenden staatlichen Hilfe zu verzweifeln droht. Getrieben von seinem Streben nach sozialer Gerechtigkeit und einem zunehmenden Pflichtbewusstsein gegenüber der jungen Frau und ihren zwei Kindern beschließt Daniel, die kleine Familie zu unterstützen, wo er nur kann. Ken Loach zeigt in seinem Film nicht nur die Herzlosigkeit des Verwaltungsapparats, sondern auch den bewegenden Sieg der Menschlichkeit darüber.Mit seinem Werk prangert Ken Loach die in den 2010er Jahren in Großbritannien beschlossenen neoliberalen Gesetze an. Die Dokumentation befasst sich auch mit den zahlreichen Reaktionen der Öffentlichkeit auf den sozialkritischen Film: In Großbritannien wurde sogar im Unterhaus über „Ich, Daniel Blake“ gestritten, und auch im Ausland fand der Film aufgrund seiner allgemeingültigen Botschaft viel Beachtung. Menschen auf der ganzen Welt erkannten sich in Daniel Blake wieder, zumal ihn ein ehemaliger Arbeiter aus Newcastle verkörperte, der als Laiendarsteller erstmals eine Hauptrolle in einem Kinofilm spielte. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 12.05.2021 arte.tv Deutsche TV-Premiere Mi. 19.05.2021 arte 25. Shoplifters – Familienbande
Folge 25 (52 Min.)Vier Erwachsene und ein Kind wohnen gemeinsam in einem heruntergekommenen Haus in Tokio. Blutsverwandt sind sie nicht, und dennoch haben sie sich für ein Leben als Patchworkfamilie am Rande der Gesellschaft und des Gesetzes entschieden. Für „Shoplifters – Familienbande“ ließ sich Regisseur Hirokazu Koreeda von wahren Begebenheiten inspirieren. Der gesellschaftskritische Film stieß international auf große Resonanz und wurde 2018 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.Die in Tokio gedrehte Dokumentation ergründet die Entstehungsgeschichte des realitätsnahen Dramas, das auch als subversiver Fingerzeig auf die Moralvorstellungen in Japan zu verstehen ist. Emmanuel Hamon und Serge July analysieren Koreedas Unmut über die prekären Lebensverhältnisse japanischer Arbeiter, über mittellose Rentner und vernachlässigte Kinder.Sie beleuchten auch eine weitere Kernproblematik des Films: die Familie als Eckpfeiler der traditionellen japanischen Gesellschaft – ein Thema, das Hirokazu Koreeda gern und häufig in seinen Werken aufgreift. Nach Ansicht des Regisseurs kann sich eine Patchworkfamilie weit näherstehen als eine biologische. Anhand von Interviews mit dem Filmemacher und seinem Team sowie exklusiven Einblicken in die Dreharbeiten zeichnet die Dokumentation das Porträt eines vielseitigen Künstlers, der seine Filme nicht nur selbst schreibt, sondern auch dreht und schneidet. (Text: arte) Deutsche TV-Premiere Mi. 26.05.2021 arte 26. 120 BPM
Folge 26 (51 Min.)Von Flyern über Sitzblockaden bis hin zu Gay-Pride-Paraden: Anfang der 90er Jahre machte Act Up Paris gegen die allgemeine Gleichgültigkeit angesichts der Aids-Epidemie mobil und rief einen spektakulären und provokanten Aktivismus ins Leben, der seither viele Nachahmer fand. 30 Jahre später drehte Robin Campillo, einst selbst Act-Up-Aktivist, einen Film über diese bewegte Zeit. „120 BPM“ erzählt, wie Aids-Kranke ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen und gemeinsam dafür kämpften, die Anti-Aids-Forschung zu beschleunigen.Anhand von Archivaufnahmen und Interviews mit dem Regisseur, der Filmcrew und dem Mitbegründer von Act Up Paris, Didier Lestrade, veranschaulicht die Dokumentation wie „120 BPM“ historische Fakten, eine Liebesgeschichte und persönliche Erinnerungen des Regisseurs miteinander verwebt. „Mich interessiert die Beziehung zwischen Privatem und Politischem“, so Robin Campillo. Mit seinem Film wollte er all jenen gerecht werden, die den Kampf gegen Aids führten. Er zeigt das tragische Schicksal einer Handvoll Aktivisten, ihre hitzigen Meetings, die aufgeladene Stimmung der Straßenaktionen, das Leid der Erkrankten, den Tod von Freunden und die tranceartigen Nächte in den Clubs, wo zu einer neuen Musik getanzt wurde: dem House. Heute ist die Aids-Epidemie zwar abgeschwächt, aber noch lange nicht vorbei. „120 BPM“ erscheint wie eine Mahnung für kommende Generationen. 2017 wurde „120 BPM“ mit dem großen Preis der Jury bei den Filmfestspielen von Cannes sowie mit sechs Césars ausgezeichnet. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 11.05.2022 arte.tv Deutsche TV-Premiere Mi. 18.05.2022 arte 27. Il traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra
Folge 27 (52 Min.)Infolge eines Krieges zwischen verschiedenen Clans der sizilianischen Mafia taucht der hochrangige Cosa-Nostra-Boss Tommaso Buscetta in Brasilien unter. Jahrelang hat er für die Cosa Nostra gemordet und Drogen geschmuggelt. Als er in Brasilien verhaftet und nach Italien ausgeliefert wird, entschließt er sich gegen die Verbrecherorganisation auszusagen – der Beginn eines historischen Gerichtsprozesses, der mit Hunderten von Verhaftungen endet und ganze Mafiastrukturen zerschlägt. Dieser Gerichtsprozess ist der Ausgangspunkt von Marco Bellocchios vielfach ausgezeichnetem Drama „Il traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra“.Marco Bellocchio gehört seit den späten 60er Jahren zu den politisch engagiertesten und kontroversesten Regisseuren Italiens. Immer wieder setzt er sich in seinen Filmen mit der Politik, der Zeitgeschichte und den Sitten seines Heimatlandes auseinander. In „Il traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra“ wirft er einen kühlen und realistischen, einen „italienischen Blick“ auf die italienische Mafia – fernab der gefälligen, idealisierenden Mythen, die in US-amerikanischen Mafiafilmen häufig Verbreitung finden. Die Dokumentation zeigt, wie Bellocchio zu der Entscheidung kam, mit den gängigen Maffia-Narrativen aus Hollywood zu brechen und warum ihn vor allem die Figur des „Verräters“ so sehr fasziniert. Bellocchios Frau – Cutterin all seiner Filme -, sein Produzent und die beiden Hauptdarsteller erzählen von den zahlreichen Zwischenfällen bei den Dreharbeiten. Zu Wort kommen außerdem Richter des Gerichtsprozesses, ehemalige Angeklagte und Mafiaspezialisten, die ihre Erinnerungen der Sicht des Filmemachers gegenüberstellen. Mit zahlreichen Archivbildern gibt die Dokumentation aufschlussreiche Einblicke in das von Geld und Heroin regierte Palermo der 80er Jahre, in dem einige der blutigsten Vergeltungsakte der Mafiageschichte stattfanden. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere So. 15.05.2022 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 22.05.2022 arte 28. Gelobt sei Gott
Folge 28 (52 Min.)CameraBild: arteDie Dokumentation zeigt, wie François Ozon mit „Gelobt sei Gott“ – im Original „Grâce à Dieu“ – ein äußerst realitätsnahes Werk geschaffen hat, dem eine umfassende Recherchearbeit vorausging. Ozon traf sich mit drei Opfern des beschuldigten Priesters. Das Drehbuch basiert auf ihren persönlichen Geschichten. Die Schauspieler Melvil Poupaud, Swann Arlaud und Josiane Balasko – Letztere in der Rolle der Mutter eines Opfers – erzählen, wie sie sich in die Figuren hineinversetzt haben. Außerdem kommen in der Dokumentation zwei der drei Opfer zu Wort.Sie sind die Gründer des Vereins La Parole libérée („das befreite Wort“), der eine federführende Rolle im Kampf gegen die Gemeinde in Lyon spielte. Jean-Marc Sauvé ist Autor eines frappierenden Berichts über sexuellen Missbrauch in der Kirche. Er unterstreicht die präzise Darstellung der Sachverhalte im Film und dessen erheblichen Einfluss auf Gesetzgebung und Kirche. Der beschuldigte Priester und das Erzbistum Lyon haben zwei Mal versucht, das Erscheinen des Films zu verhindern. „Gelobt sei Gott“ erschien allem Widerstand zum Trotz inmitten der MeToo-Bewegung und lockte eine Million Zuschauer in die Kinos. Sowohl die Darsteller als auch die einstigen Opfer nahmen an zahlreichen Debatten rund um das Werk teil. Ob Melodrama, Thriller oder Komödie – Ozons Filmographie kennt keine Genregrenzen. Mit „Gelobt sei Gott“ reiht sich nun ein für den Rechtsstaat unverzichtbarer Film an der Grenze zwischen Dokumentarfilm und Fiktion in die Liste seiner Meisterwerke ein. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 31.05.2023 arte.tv Deutsche TV-Premiere Mi. 07.06.2023 arte 29. Teheran Connection
Folge 29 (52 Min.)Trotz des erbitterten Kampfes von Polizei und Justiz gegen die Drogenhändler nimmt die Anzahl der Drogenabhängigen im Iran kontinuierlich zu. „Teheran Connection“, der Film des jungen Filmemachers Saeed Roustaee, erzählt die Geschichte des Elends in seiner Heimat. In der Dokumentation „Es war einmal … Teheran Connection“ beschäftigt sich Pierre-Olivier François mit der Entstehungsgeschichte des Filmdramas. Dem Dreh ging eine monatelange Recherchearbeit im Polizeiwesen und bei den Justizbehörden voraus. Dabei stellte der Regisseur Roustaee fest, dass der Drogenhandel die iranische Gesellschaft unterwandert hat und nicht nur erhebliche gesundheitliche Schäden verursacht, sondern auch die Korruption befeuert.Anhand von Interviews mit dem Filmemacher und seinem Team sowie Archivbildern, unveröffentlichtem Material, Plänen und Modellen wird deutlich, unter welch widrigen Umständen der Film überhaupt zustande kam. Es entstanden erschütternde Szenen mit Hunderten von drogenabhängigen Laienschauspielern. Die Protagonisten – Drogenhändler ebenso wie Polizisten – werden allerdings weder karikiert noch in gut und böse unterteilt. Trotz vieler Schwierigkeiten mit der Zensurbehörde kam „Teheran Connection“ 2019 mit großem Erfolg in die iranischen Kinos; die Dokumentation zeigt Bilder der Warteschlangen vor den Kinos und die Reaktionen der Zuschauer. Zum ersten Mal wurde das Ausmaß des Drogenproblems im Iran dargestellt und umfassend thematisiert. Für diejenigen, die bei Pierre-Olivier François vor der Kamera sprechen, spiegelt diese katastrophale Lage den Zustand der iranischen Gesellschaft. Genau deshalb war „Teheran Connection“ für die Iraner ein so wichtiger Meilenstein und machte Saeed Roustaee zur Galionsfigur einer neuen Generation iranischer Filmemacher. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 17.04.2024 arte.tv Deutsche TV-Premiere Mi. 24.04.2024 arte 30. Die Kairo Verschwörung (La Conspiration du Caire)
Folge 30 (52 Min.)Als in Kairo der Großimam stirbt, entbrennt an der renommiertesten religiösen Hochschule Ägyptens, der Al-Azhar-Universität, ein unerbittlicher Kampf um dessen Nachfolge. Ein junger Student gerät ins Zentrum dieses erbarmungslosen Konflikts. Hinter den verschlossenen Türen dieser scheinbar ruhigen Welt entscheidet sich das Schicksal des Landes. „Die Kairo Verschwörung“ ist der sechste Film des ägyptisch-schwedischen Regisseurs Tarik Saleh. Der 2022 in Cannes mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnete Film bewegt sich zwischen Krimi und Politthriller und ist eine lose Fortsetzung des 2017 erschienenen Spielfilms „Die Nile Hilton Affäre“.Die Dokumentation beleuchtet die Entstehung und die Hintergründe des Werks. Gedreht wurde in Istanbul. Zu sehen sind arabische Schauspieler mit Wurzeln im Libanon, Palästina, Israel, Syrien und Tunesien. In ausführlichen Interviews spricht Regisseur Tarik Saleh über seine Vorliebe für Genrefilme und verborgene Welten. Er erzählt von seiner Faszination für die Azhar, das Machtzentrum des sunnitischen Islam, welches das Militär immer wieder unter seine politische Kontrolle zu bringen versucht. „Die Kairo Verschwörung“ ist ein Film über Macht und Gewalt – ob politisch oder religiös motiviert. Die Dokumentation stellt den in Schweden geborenen Filmemacher Tarik Saleh vor, der als Sohn eines ägyptischen Vaters und einer schwedischen Mutter zwischen zwei Kulturen steht – der arabischen und der europäischen, der muslimischen und der christlichen. Saleh selbst sagt, er sei „mehr Ägypter als Schwede“. Weil er vom Regime als zu kritisch beurteilt wird, darf der Regisseur weder einreisen noch seine Filme in Ägypten zeigen. Ohne sich allzu großen Illusionen hinzugeben, träumt Saleh dennoch davon, eines Tages zurückkehren zu können. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere So. 17.11.2024 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 24.11.2024 arte 31. Wie wilde Tiere
Folge 31 (52 Min.)Deutsche Streaming-Premiere Mi. 10.12.2025 arte.tv
zurück
Erhalte Neuigkeiten zu Es war einmal … direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Es war einmal … und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail