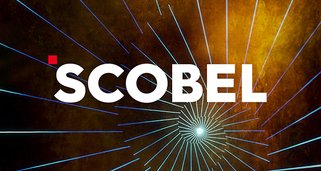Verrohter Diskurs
Folge 422 (60 Min.)Öffentliche und private Kommunikation verändern sich. Diskussionen werden hitziger, der Wille zum Austausch nimmt ab. Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Diskurs ist ein wesentlicher Bestandteil von Demokratie. Wenn verschiedene Perspektiven nicht mehr konstruktiv aufeinandertreffen, wird es schwierig, gemeinsame Lösungen zu finden. Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen. Was vor einigen Jahren vor allem in sozialen Medien beobachtet wurde, hat inzwischen auch in persönliche und politische Debatten Eingang gefunden.
Doch woran liegt das? Wie kommt es zu dieser Krise des Sprechens? Unsere Gesellschaft ist nach der Bundestagswahl polarisierter denn je. Kompromisse werden immer unwahrscheinlicher, wenn alle auf verhärteten Positionen beharren. Das ist in der Politik genauso wie in Familien- und Paarbeziehungen. doch wenn wir einander nicht mehr zuhören können, wie können wir dann miteinander ein gutes Leben führen? Wie eine Politik kreieren, die Probleme wirklich löst? Welche Formen des Kommunizierens können diese Spaltung auflösen und zu einem konstruktivem Miteinander führen? Klar ist: Wir müssen einander zuhören, auch denen, die wir als „anders“ empfinden, die unsere Gewissheiten infrage stellen.
Aber: Ist die „Diskursverwilderung“ tatsächlich so omnipräsent, dass wir den Untergang der Gesprächskultur beschwören – oder übersehen wir das, was sich an Positivem eben auch entwickelt hat? Sind Respekt und Rationalität bereits verlorengegangen in den immer heftiger ausgetragenen Debatten in Talkshows und Netzkommentaren? Intellektuelle bemängeln seit Jahren den Trend, jeder Position eine Gegenposition gegenüberzustellen.
Wie aber könnte man komplexer über politische Inhalte debattieren – ohne eine Position, der zwanghaft immer eine konturierte Gegenposition folgt? Brauchen wir gerade jetzt nicht mehr Eindeutigkeit in der Widerrede? Und – können wir einander besser verstehen, wenn wir akzeptieren würden, dass unsere gefühlte Wahrheit nicht unbedingt die tatsächliche oder einzige Wahrheit ist? Gert Scobel lotet mit seinen Gästen aus, welche Möglichkeiten es gibt, wieder entspannt miteinander in ein konstruktives Gespräch zu kommen – privat wie politisch. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Do. 08.05.2025 3sat Gemeinsam gegen Demenz
Folge 423 (60 Min.)Demenz – eine der größten gesundheitlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Pflege, die Kosten, die Belastung der Angehörigen: Probleme, für die es bislang keine Lösungen gibt. Und die Situation spitzt sich zu: Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Demenzkranken auf etwa 2,2 Millionen stark ansteigen. Demenz gilt als eine der folgenreichsten psychischen Erkrankungen im Alter. Die Pflege und psychosoziale Betreuung ist extrem aufwendig. Die vorhandenen Pflegekräfte reichen bei Weitem nicht aus, um die steigende Zahl an Pflegebedürftigen in Zukunft – qualitativ gut – zu versorgen.
Gemessen am steigenden Bedarf sinkt die Zahl junger Menschen, die sich für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden. So wird die Schere zwischen dem Versorgungsbedarf und der realen Versorgung in den kommenden Jahren weiter auseinandergehen. Eine bedürfnisgerechte Versorgung für pflegebedürftige Menschen wird bald nicht mehr gewährleistet sein können. Versorgungskonzepte müssen flexible, altersgerechte Betreuungsmodelle und Unterstützung für Angehörige umfassen. Die aktuelle Forschung zeigt, dass regelmäßige soziale Kontakte und gemeinsame Aktivitäten den Krankheitsverlauf bei Demenzkranken verlangsamen können.
Arbeitgeber müssten also für betreuende Angehörige vermehrt flexible Arbeitszeiten und Homeoffice anbieten. Denn Betreuung erfolgt meist zu Hause. Spezialisierte Heime sind rar. Wie können Risikofaktoren besser identifiziert und präventive Maßnahmen effektiv umgesetzt werden, um die Inzidenz von Demenz zu senken? Welche innovativen Pflegekonzepte können entwickelt werden, um die Lebensqualität von Demenzkranken zu verbessern und die Belastung der Pflegekräfte zu reduzieren? Wie kann die soziale Isolation von Demenzkranken, insbesondere die jüngeren Betroffenen, verringert werden? Welche ethischen Richtlinien sollten bei der Pflege und Betreuung von Demenzkranken beachtet werden, um Würde und Autonomie zu wahren? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen Christine von Arnim, Annette Riedel und Wolfgang Hoffmann.
Christine von Arnim ist Direktorin der Klinik für Geriatrie an der Universitätsmedizin Göttingen. Die Neurologin erforscht unter anderem Ursachen und Folgen von Demenz sowie Prävention und Therapie durch Faktoren wie Ernährung, körperliche und geistige Aktivität.
Annette Riedel lehrt und forscht an der Hochschule Esslingen mit den Schwerpunkten Pflegewissenschaft und Ethik. In ihrer Arbeit widmet sie sich der Entwicklung ethischer Leitlinien. Seit 2020 ist sie Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wolfgang Hoffmann ist Geschäftsführender Direktor des „Institut für Community Medicine“ an der Universitätsmedizin Greifswald und leitet den Bereich „Versorgungsepidemiologie und Community Health“. Er untersucht unter anderem, wie ein zukunftsfähiges und resilientes Gesundheitssystem aussehen muss. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Do. 15.05.2025 3sat Intelligenz
Folge 424 (60 Min.)Sie ist ein komplexes Phänomen, das nicht nur durch den IQ bestimmt wird: Intelligenz wird oft mit kognitiven Fähigkeiten und Problemlösungsvermögen assoziiert. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Intelligenz Erfolg und Gesundheit fördert, indem sie analytisches Denken und fundierte Entscheidungen unterstützt. Die Integration von Künstlicher Intelligenz in Bildung und Forschung bietet neue Möglichkeiten, diese Phänomene besser zu verstehen und zu adressieren. KI kann personalisierte Lernwege schaffen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind und so die kognitiven Fähigkeiten fördern.
Durch adaptive Lernplattformen und intelligente tutorielle Systeme können Schüler und Studenten in ihrem eigenen Tempo lernen und gezielt unterstützt werden. Gleichzeitig wirft der Einsatz von KI ethische Fragen auf, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und die Verstärkung bestehender Ungleichheiten im Bildungsbereich. Kann KI dazu beitragen, die Grenzen zwischen Intelligenz und Dummheit weiter zu verwischen, indem sie nicht nur kognitive, sondern auch emotionale Intelligenz fördert? Könnte dies zu einer Gesellschaft führen, in der fundierte Entscheidungen und reflektiertes Handeln die Norm sind? Oder spielen letztendlich Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Disziplin, Zivilcourage oder Fantasie eine viel größere Rolle auf dem Weg zu einem gelingenden Leben als kognitive Stärke, Intelligenz und KI? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen Karoline Wiesner, Katharina Zweig und Jakob Pietschnig.
Karoline Wiesner ist Professorin für Komplexitätswissenschaft am Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam.
Sie forscht zur Informationstheorie für komplexe Systeme, zur Dynamik der Demokratie und zu neuronalen Netzen. Katharina Zweig ist Professorin für Informatik der TU Kaiserslautern, wo sie den deutschlandweit ersten Studiengang Sozioinformatik schuf, der die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft untersucht. Jakob Pietschnig leitet den Arbeitsbereich für „Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik“ am Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung an der Universität Wien. Er forscht seit vielen Jahren zum Thema Intelligenz. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Do. 05.06.2025 3sat Wissenschaft in der Vertrauenskrise
Folge 425 (60 Min.)Wissenschaft bringt Fortschritt und Orientierung. Solange sie beschreibt, was ist. Doch Fälschungen und KI-generierte Fake-Wissenschaft bringen den Elfenbeinturm des Wissens ins Wanken. Wissenschaftliche Redlichkeit und die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis sind die Vertrauensgrundlage der modernen Wissenschaft. Doch nicht alle halten sich daran. Betrug und Fälschungen gibt es zunehmend auch an Hochschulen und Forschungsinstituten. Doch was kommt auf uns zu, wenn nun künstliche Intelligenz in den Wissenschaftsbetrieb Einzug hält? Sogenannte Paper Mills – Papiermühlen – publizieren schon heute jährlich Hunderttausende gefälschte wissenschaftliche Studien und Artikel.
Diese verschmutzen nicht nur das globale Wissen, sondern unterminieren auch das Vertrauen in die Wissenschaft. Eine Studie mit KI zu fälschen, ist inzwischen kinderleicht. Das seit der Coronazeit gestiegene Vertrauen in die Wissenschaft könnte auch schnell wieder verspielt werden. Es sei denn, der Wissenschaftsbetrieb passt sich den neuen Entwicklungen an und setzt in Zukunft beim Publikationswesen statt auf Masse wieder mehr auf Klasse.
Darüber diskutiert Gert Scobel diesmal mit seinen Gästen: Alena Buyx ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München. Ihre Forschung umfasst biomedizinische und öffentliche Gesundheitsethik und Fragen der Solidarität und Gerechtigkeit. 2020 bis April 2024 war sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Carsten Könneker ist Wissenschaftsjournalist und Redaktionsleiter bei „Spektrum der Wissenschaft“.
Von 2012 bis 2018 war er Professor für Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Gründungsdirektor des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation. Bernhard Sabel leitete bis September 2023 das Institut für Medizinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg. Der Psychologe beschäftigt sich mit dem Phänomen des Wissenschaftsbetrugs durch Fake-Publikationen. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Do. 12.06.2025 3sat
scobel: Wochen-Vorschau
Hol dir jetzt die fernsehserien.de App