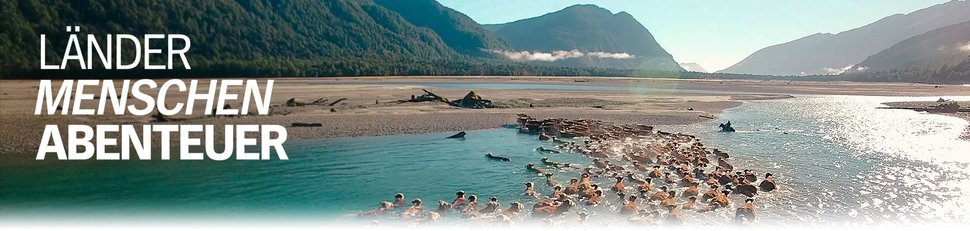1783 Folgen erfasst, Seite 9
Australien – Quer durch das heiße Herz
Neun von zehn Australiern leben in den großen Städten des Landes. Das riesige, heiße Herz des Kontinents, das Outback, ist dagegen fast menschenleer. Aber diejenigen, die hier leben, sind echte Typen. Die Zuschauer begleiten die LKW-Fahrer Rick und Vicki Foote, ein Ehepaar, das seit zwölf Jahren einmal wöchentlich ganz Australien von Süd nach Nord und retour durchquert: 5.400 Kilometer. Einer fährt, der andere schläft. Die „Truckies“, so heißen LKW-Fahrer in Australien, sind über 1.000 Mal den Stuart Highway von Adelaide im Süden bis Darwin im Norden hinauf- und wieder heruntergefahren.Die Straße ist in Australien ähnlich mythenumrankt wie die Route 66 in den USA. Erst seit Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist der Stuart Highway asphaltiert. Aber er birgt noch immer Gefahren: Buschbrände etwa und sogar große Überflutungen nach den seltenen Regenfällen. Rick liebt die Straße bis heute: „Wir haben Trucks in buchstäblich jede größere Stadt Australiens gefahren, aber das hier ist die beste Tour, die es gibt: der Stuart Highway! Diese Straße hat irgendwas, du willst sie nicht mehr verlassen.“ „Rick and Vic“ fahren einen riesigen „Road Train“, er ist 54 Meter lang, zieht 130 Tonnen und kostet über eine Million Dollar. Zum Vergleich: Die derzeit viel diskutierten europäischen „Gigaliner“ sind maximal 25 Meter lang. Ohne die Kings of the Outback genannten größten LKW der Welt könnten die winzigen Ortschaften und die Menschen auf den entlegenen Farmen im „heißen Herz“ nicht überleben. „Rick and Vic“ durchqueren das Outback – sie bringen drei randvoll mit frischen Lebensmitteln gefüllte Anhänger zu Supermärkten im Norden, wo es kaum Industrie gibt. Jeder Joghurt wird so erst 2.700 Kilometer gekühlt durch die Halbwüste gefahren, ehe er in Darwin und Umgebung auf dem Tisch landet. Vicki fährt seit 30 Jahren Road Trains, anfangs war es schwer: „Damals gab es sehr viele Machos und kaum Frauen in dem Job, wahrscheinlich hättest du sie an den Fingern abzählen können. Die Männer wollten uns nicht in ihrer Welt. (Text: SWR) Australiens Channel-Country: Hoffen auf die Flut
Das Channel Country im Outback ist eines der trockensten Gebiete Australiens. Trotzdem wird hier seit 150 Jahren Viehzucht betrieben. Das Leben hier ist hart, staubig und eintönig. Die Dürre der letzten Jahre war extrem. Aber alle 5 bis 10 Jahre verwandelt sich diese Welt, explodiert buchstäblich das Leben und die Wüste blüht. Nach den außergewöhnlich starken Monsunregen im Januar und Februar dringt mehr Wasser als sonst in die ausgetrockneten Flussbetten und fließt durch unzählige kleine Kanäle, Bäche und Spalten langsam nach Süden in Richtung auf den Lake Eyre-Salzsee.Es grünt und blüht überall, riesige Schwärme von Wasservögeln tauchen plötzlich auf und die Rinderzüchter strahlen, wenn ihre Farmen unter Wasser stehen. Die Farmen sind 50 000 Hektar und noch größer und liegen in der Regel Hunderte von Meilen auseinander. Das einzige Transportmittel ist das Sportflugzeug. Fliegen ist eine Selbstverständlichkeit für alle Familienmitglieder, und sei es, um die Kinder zum Geburtstag des Nachbarkindes, 200 km entfernt, zu bringen. (Text: BR Fernsehen) Australiens Mississippi – Der Murray-River
Der Murray, den der Schriftsteller Mark Twain den „Mississippi Australiens“ nannte, ist der größte Fluss des fünften Kontinents. Er schlängelt sich durch New South Wales, Victoria und Queensland und mündet nach 3.000 km in den südlichen Ozean. Einst stand der Fluss für Siedlerträume und Fülle. Heute steht er für den verantwortungsvollen Umgang mit einer der kostbarsten Ressourcen, dem Wasser. (Text: Planet)Australiens Nationalparks (1): Die Alpen
Australien ist der älteste Kontinent der Erde. Seit Millionen von Jahren vom Rest der Welt isoliert, gedeihen dort einzigartige Pflanzen und Tiere. Die fünfteilige Reise durch spektakuläre Nationalparks führt in die Wildnis Australiens. Die Route durchquert üppigen Regenwald und führt auf schneebedeckte Berge. Das Filmteam beobachtet Walhaie, die durch Korallenriffe tauchen, sucht in den tasmanischen Wäldern nach den letzten Beutelteufeln und beobachtet Rote Riesenkängurus in der Wüste. Im Südosten des Fünften Kontinents liegen die Australischen Alpen. Sie werden vom Snowy River durchschnitten, an dessen Ufern die Brumbies, Wildpferde, leben.Der Nationalpark Australische Alpen erstreckt sich über drei Bundesstaaten. Durch die tiefen Täler fließt der wilde Snowy River, der an den Hängen des Mount Kosciuszko entspringt. Rund um den Mount Kosciuszko schneit es im Winter regelmäßig. Dort lebt der Bergbilchbeutler, das einzige Beuteltier Australiens, das Winterschlaf hält und Vorräte anlegt. Nach der Schneeschmelze benötigt das hamstergroße Tier reichhaltige Nahrung, die in erster Linie aus Bogong-Faltern besteht. Doch die Klimaveränderung gefährdet die Existenz der Bergbilchbeutler. Steht das nahrhafte Futter nicht zum rechten Zeitpunkt zur Verfügung und schmilzt der Schnee bereits vor der Ankunft der Bogong-Falter, müssen die Bergbilchbeutler verhungern. Am Snowy River leben auch viele Wildpferde, so genannte Brumbies. Einst waren sie die Reitpferde der australischen Cowboys. Inzwischen sind sie zur Plage in den Nationalparks geworden, weil sie mit ihren harten Hufen den Boden zerstören. Als sie von der Parkleitung vorübergehend zum Abschuss freigegeben wurden, war die öffentliche Empörung groß. Nun werden die Brumbies mit viel Aufwand eingefangen und verkauft. Doch das reduziert den Bestand kaum. Die Freunde der Brumbies beharren auf der kulturellen Bedeutung der Pferde und verweisen auf das australische Nationalepos des Dichters Andrew „Banjo“ Paterson, der Pferd und Reiter verherrlicht. Glen Symonds und seine Frau Julie nehmen eingefangene Brumbies auf und bilden sie zu Reitpferden für Kinder aus. Das erfordert viel Geduld und Mühe. Im Frühjahr, wenn auf den Bergkuppen noch Schnee liegt, kann man dem lautstarken Ritual des Leierschwanzvogels lauschen, der sämtliche aufgeschnappte Vogelstimmen nachzuahmen weiß. Oder man sichtet auch Graue Riesenkängurus, die auf den hochalpinen Almen Gras fressen. (Text: NDR) Australiens Nationalparks (2): Der Regenwald
Australien ist der älteste Kontinent der Erde. Seit Millionen von Jahren vom Rest der Welt isoliert, gedeihen dort einzigartige Pflanzen und Tiere. Die fünfteilige Reise durch spektakuläre Nationalparks führt in die Wildnis Australiens. Die Route durchquert üppigen Regenwald und besteigt schneebedeckte Berge. Das Filmteam beobachtet Walhaie, die durch Korallenriffe tauchen, sucht in den tasmanischen Wäldern nach den letzten Beutelteufeln und beobachtet Rote Riesenkängurus in der Wüste. Die Korallen des Great-Barrier-Reefs reichen bis an den makellos weißen Strand heran, von dort aus zieht sich ein dichter Regenwald die Berghänge hinauf.Der Daintree-Nationalpark ist der verbliebene tropische Lebensraum, der sich früher über den gesamten Norden Australiens erstreckte. Klimaveränderungen ließen den Regenwald über Jahrtausende stark schrumpfen, Rodungen durch Menschen dezimierten ihn zusätzlich. Doch im Nationalpark haben zahlreiche Pflanzen- und Tierarten aus der Frühzeit des Kontinents überlebt. Direkt am Rand des Daintree-Nationalparks steht ein Baukran, made in Germany. Er ist Teil eines Regenwaldlabors und dient der Erforschung des Kronendachs. Peter Byrnes von der Universität Cairns leitet die Regenwaldforschungsstation, Andrew Thompson ist sein technischer Assistent. 2010 haben die Regenwaldforscher eine Studie über Käfer erstellt. Im Regenwald leben auch die Kasuare, flugunfähige Riesenvögel. Wegen ihrer auffällig bunten Hals- und Kopffarben werden sie auch als die Juwelen des Dschungels bezeichnet. Die Schmuckdesignerin Liz Gallie hat sich zur Fürsprecherin der Kasuare gemacht. Sie bewundert die Riesenvögel und nimmt ihre Farben als Vorlagen für ihre Kreationen. Auch das Lumholtz-Baumkänguru lebt im Regenwald. Trotz seiner mächtigen Krallen ist es aber kein wirklicher Kletterkünstler. Die aus Stuttgart stammende Tierpflegerin Margit Cianelli kümmert sich um verletzte Tiere und zieht verwaiste Baumkängurukinder groß. (Text: ARD-alpha) Australiens Nationalparks (3): Die Insel der Teufel
Australien ist der älteste Kontinent der Erde. Seit Millionen von Jahren vom Rest der Welt isoliert, gedeihen dort einzigartige Pflanzen und Tiere. Die fünfteilige Reise durch spektakuläre Nationalparks führt in die Wildnis Australiens. Die Route durchquert üppigen Regenwald und besteigt schneebedeckte Berge. Das Filmteam beobachtet Walhaie, die durch Korallenriffe tauchen, sucht in den tasmanischen Wäldern nach den letzten Beutelteufeln und beobachtet Rote Riesenkängurus in der Wüste. Der Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark ist ein Juwel unter Australiens Nationalparks. Er ist Teil der Wildnis, die fast den gesamten Westen Tasmaniens, der größten australischen Insel, bedeckt.Sturmumtost liegt sie 240 Kilometer südlich des Festlandes im Wirkungskreis südpolarer Stürme. Aufgrund der isolierten Lage konnten auf Tasmanien zahlreiche Arten wie die letzten eierlegenden Säugetiere überleben. Im Winter sind Gipfel und Seen des Nationalparks mit Schnee und Eis bedeckt, im Sommer, also im Dezember und Januar, blühen die Blumen auf den Wiesen. Das spektakulärste Tier des Parks ist der Tasmanische Teufel, das größte fleischfressende Beuteltier. Doch seit 1996 grassiert auf Tasmanien eine mysteriöse Krankheit unter den Tieren, die den Bestand gefährdet. Samantha Fox gehört zur „Devil Task Force“, die die Tiere retten will. Und Wade Anthony hat mit einem Schutzgebiet am Fuße des Cradle-Mountain-Massivs für Interessierte eine Möglichkeit geschaffen, die nachtaktiven Räuber zu beobachten und ihre lautstarken, spektakulären Auseinandersetzungen hautnah mitzuerleben. Während nachts die Beutelteufel auf die Jagd gehen, halten tagsüber die mächtigen Keilschwanzadler über den Wäldern nach Beute Ausschau. Aus der Perspektive dieser Adler lässt sich die Schönheit der eindrucksvollen Landschaft genießen. In einzigartigen Luftaufnahmen zeigen die Filmemacher die unwegsamen Weiten der Insel, deren dichte Wälder, zerklüftete Basaltgipfel und endlose Heidelandschaften. (Text: ARD-alpha) Australiens Nationalparks (4): Die Küste der Walhaie
Australien ist der älteste Kontinent der Erde. Seit Millionen von Jahren vom Rest der Welt isoliert, gedeihen dort einzigartige Pflanzen und Tiere. Die fünfteilige Reise durch spektakuläre Nationalparks führt in die Wildnis Australiens. Die Route durchquert üppigen Regenwald und besteigt schneebedeckte Berge. Das Filmteam beobachtet Walhaie, die durch Korallenriffe tauchen, sucht in den tasmanischen Wäldern nach den letzten Beutelteufeln und beobachtet Rote Riesenkängurus in der Wüste. Das UNESCO-Weltnaturerbe Shark Bay liegt in der Nähe des Ningaloo Riffs, an der Westküste Australiens.Jedes Jahr zwischen März und Juni wird die Bucht zum Futterplatz für Walhaie, die größten Fische der Erde, die sich von Plankton und vom eiweißreichen Laich der Korallen ernähren. Der Meeresbiologe Mark Meekan kommt seit zehn Jahren an die Küste, um das Geheimnis der Walhaie zu erforschen. Auf einer Landzunge aus tiefrotem Sand schiebt sich der François-Péron-Nationalpark weit in die flachen Gewässer der Shark Bay. Dort liegt „Project Eden“, ein Paradies für Beuteltiere. Nicole Godfrey arbeitet seit zwölf Jahren an der Aufzucht der letzten Zottel-Hasenkängurus und Kaninchennasenbeutler Australiens, die im Parkgelände ausgesetzt werden sollen. Doch die bekannteste Attraktion von Shark Bay ist der Strand von Monkey Mia. Vor 23 Jahren kam die Meeresforscherin Janet Mann aus den USA erstmals in die Region. Sie hörte von Delfinen, die hier nahe am Strand schwimmen und eine eigene Jagdtechnik entwickelt haben. Sie sah die großartige Chance, die außergewöhnliche Gruppe von Meeressäugern in ihrer natürlichen Umgebung zu erforschen. Das Kamerateam begleitet sie bei der Beobachtung von jagenden Delfinen, die als einzige Delfinpopulation der Welt Werkzeuge zur Jagd benutzt. (Text: ARD-alpha) Australiens Nationalparks (5): Die Rote Wüste
Australien ist der älteste Kontinent der Erde. Seit Millionen von Jahren vom Rest der Welt isoliert, gedeihen dort einzigartige Pflanzen und Tiere. Die fünfteilige Reise durch spektakuläre Nationalparks führt in die Wildnis Australiens. Das Filmteam durchquert auf seiner Route üppigen Regenwald und besteigt schneebedeckte Berge, taucht mit Walhaien durch Korallenriffe, sucht in den tasmanischen Wäldern nach den letzten Beutelteufeln und beobachtet Rote Riesenkängurus in der Wüste. Der Gebirgszug MacDonnell erstreckt sich einige Hundert Kilometer in westöstlicher Richtung durch das ansonsten vollkommen flache, wüstenartige Zentrum Australiens.Nur die berühmten abgeschliffenen Sandsteinkuppen von Kata Tjuta (früher: The Olgas) und Uluru (früher: Ayers Rock) ragen noch aus dieser riesigen Ebene heraus. 1992 wurde die Bergkette auf ihrer gesamten Länge zum Nationalpark West-MacDonnell-Ranges erklärt. Das vor 350 Millionen Jahre entstandene Gebirge wird von mehreren Flussläufen durchschnitten, der bekannteste von ihnen ist der Finke River, eines der ältesten Flusssysteme der Erde. Kaum ein anderer kennt die Natur dieser Region so gut wie der deutschstämmige Botaniker Peter Latz. Er wuchs in Hermannsburg auf, einer Missionsstadt am Südrand der West Macs. Seine Jugendfreunde waren Aborigenes der Aranda, deren Sprache er beherrscht. Krater und eigenwillig geformten Felslandschaften prägen die Region. Für die Aborigenes, die Ureinwohner, sind die Landschaftsformationen lebendig, Spuren der mythischen Regenbogenschlange aus der spirituellen Traumzeit, die durch die Erklärungen und Anekdoten des Botanikers Peter Latz auch dem Europäer verständlich werden. Grasland, Heidelandschaft, Regenwald, Wüste und schroffe Berge, die Wildnis Australiens hat viele Gesichter. Die fünfteilige Dokumentationsreihe führt durch ganz verschiedene Regionen des Fünften Kontinents. (Text: NDR) Australiens schönste Küstenstraße – Die Great Ocean Road (1)
45 Min.Eine der schönsten und spektakulärsten Küstenstraßen der Welt beginnt direkt hinter der australischen Millionenmetropole Melbourne: die Great Ocean Road im Süden des fünften Kontinents. Spektakulär und dramatisch schlängelt sie sich die Küste entlang, immer begleitet von den Wellen des Südlichen Ozeans. Der zweiteilige Film „Australiens schönste Küstenstraße“ stellt die Region sowie die Menschen und Tiere vor, die entlang der Great Ocean Road leben.July und Tuby sind die tierischen Leibwächter einer Kolonie von Zwergpinguinen auf Middle Island. Das nah vor der Küste liegende Eiland wurde immer wieder von schwimmenden Füchsen heimgesucht, die die Pinguine fast ausgerottet hätten. Erst seit Maremma Sheepdogs (italienische Hirtenhunde) wie July und Tuby nachts die Insel bewachen, geht es langsam wieder aufwärts mit der Population. Die Meeresbiologin Jess Bourchier kommt mit einer Schar von Freiwilligen regelmäßig hierher, um den Gesundheitszustand der Tiere zu überwachen und sie zu zählen. Ein faszinierendes Spektakel, nicht nur für July und Tuby. Ein Bad im kühlen südlichen Ozean macht müde Beine munter. Davon ist Pferdezüchter Symon Wilde überzeugt und schickt seine Galopper samt Jockeys hier regelmäßig zum Schwimmen. Der Erfolg gibt ihm recht: Bei den entlang der Great Ocean Road äußerst beliebten Pferderennen räumt er regelmäßig Trophäen ab. Seit 35 Jahren sucht der Paläontologe Tom Rich nach versteinerten Überresten der Tiere, die einst die Erde beherrschten. Ihm sind zahlreiche Entdeckungen gelungen, die Licht in das Zeitalter der Dinosaurier in Australien gebracht haben. Für Tom aber noch nicht genug: Drei Wochen lang gräbt und meißelt sein Team an der Küste entlang der Great Ocean Road, danach werden die neuesten Funde in den Labors des Melbourne Museums näher untersucht. Vielleicht ist ja wieder eine spektakuläre Entdeckung dabei. Die deutschstämmige Franziska Herzog hat sich in Australien einen Lebenstraum erfüllt. Sie wurde Hubschrauberpilotin. Jetzt arbeitet sie für ein kleines Unternehmen, das auch Rundflüge für Touristen anbietet. Die Route führt über eine der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten Australiens. Die Twelve Apostles, eine Reihe von Felsen, die vor der Küste wie Solitäre einsam und dramatisch aus dem Wasser aufragen. Bei ihrem Anblick aus der Vogelperspektive bleibt manchem Fluggast glatt die Luft weg. Doch Franziska träumt längst von noch spektakuläreren Einsätzen: Sie will Rettungsfliegerin werden oder Buschfeuer aus der Luft löschen. Auch Graeme Wilkie hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Der Künstler kaufte sich ein heruntergekommenes Anwesen unweit der Great Ocean Road und errichtete dort in Eigenregie ein Kulturzentrum. Dort stellt er seine Skulpturen, aber auch die Werke anderer Künstler aus. Qdos Arts, so hat Graeme Wilkie sein Kulturzentrum genannt, präsentiert die Kunst in wechselnden Ausstellungen. Den weitläufigen Garten des Anwesens hat er in einen Skulpturenpark verwandelt. Seine treuesten Besucher: eine Gruppe offenbar kunstsinniger Kängurus, die hier jeden Tag vorbeischaut. Die heimtückischen Gewässer vor Cape Otway sind unberechenbar. Shipwreck Coast, die Küste der Schiffswracks, heißt sie bis heute. Rex Mathieson kennt viele der Wracks, die auf dem Meeresgrund liegen. Über 30 Jahre lang hat der begeisterte Taucher den Meeresboden nach versunkenen Schiffen abgesucht. Er zeigt in dieser Dokumentation sein spektakulärstes Wrack: den Frachtsegler „Antares, der hier im Jahre 1914 versunken ist. Sechs Meter unter Wasser liegen noch Überreste des Schiffswracks und seiner Ladung. Selbst Tauchgänge sind hier wegen der tückischen Strömung lebensgefährlich. (Text: NDR) Australiens schönste Küstenstraße – Die Great Ocean Road (2)
45 Min.Australiens unbekanntes Paradies – Die Inseln der Torres-Straße
45 Min.Aus der Torresstraße, der seichten warmen Meerenge zwischen Australien und Papua-Neuguinea, erheben sich über 270 Inseln mit weißen Korallensandstränden. Ein entlegener und exotischer Archipel, den in Europa kaum jemand kennt. Kulturell ist er näher an der Südsee als an Australien gelegen. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die sogenannten Torres Strait Islander, sind nicht mit den australischen Aborigines verwandt, sondern haben ihre Wurzeln in Melanesien. Schon der Name der Hauptinsel klingt nach Robinson Crusoe: Thursday Island, die Donnerstagsinsel. Das Leben im entlegenen Südseeparadies hat seine Herausforderungen: Die rund 20 bewohnten Inseln liegen oft viele Kilometer voneinander entfernt.Kaum eine eignet sich für einen Flugplatz. Wer seine Familie und Freunde besuchen will, muss über ein Meer mit unberechenbaren Gezeitenströmungen reisen. Auch Frachtschiffe, die die Inseln vom Festland aus mit Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Dingen versorgen, kommen nicht immer pünktlich an, wie Matrose Lachie McDermott berichtet. Der Isolation und Ressourcenknappheit begegnen die Ureinwohner seit jeher mit großem Einfallsreichtum. Da das Internet noch längst nicht überall angekommen ist, ist das lokale Radio nach wie vor die zentrale Instanz, über die die Menschen miteinander kommunizieren, Grüße ausrichten und ihre Treffen verabreden. Die Dokumentation begleitet einige Insulaner der Torresstraße. Dazu gehört der Ranger Barry Pau, der jahrhundertealte Fischfallen betreut. Wally Kris, der den Kindern die überlieferten Tänze lehrt. Der Künstler Ken Thaiday, der traditionelle, bewegliche Tanzmasken und Skulpturen schnitzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich mit dem Inselleben arrangiert. Schwangere Frauen werden von der „fliegenden“ Hebamme Paula Dawson betreut, die jährlich Tausende Flugmeilen zurücklegt, damit sie die Frauen auf ihren abgelegenen Heimatinseln besuchen kann. Die Lokalzeitung wird von Aaron Smith geleitet. Er ist Redakteur, Fotograf und Zeitungsjunge zugleich und froh, wenn die auf dem Festland gedruckte Zeitung rechtzeitig mit dem Schiff ankommt. Sie ist wohl die einzige Zeitung der Welt, die es nicht im Internet gibt. Diese Dokumentation bietet überraschende Einblicke in einen der letzten weißen Flecken auf der Landkarte der Weltreisenden: eine einzigartige Inselwelt, paradiesisch und rau zugleich. (Text: NDR) Der Ayers Rock
Der Ayers Rock ist ein Felsenriese, der schon seit den Zeiten der Dinosaurier in der Nähe der geographischen Mitte Australiens höher als ein Wolkenkratzer aufragt. Benannt wurde er Ende des 18. Jahrhunderts nach dem damaligen obersten Verwaltungsbeamten Südaustraliens, Sir Henry Ayers. Der Berg ist weltweit so bekannt, dass ihn australische Werbeleute gerne als Markenzeichen benutzen. Die Aborigines, die Urweinwohner, verehren diesen Monolithen, dessen Basis mehr als neun Kilometer umfasst, schon seit Jahrtausenden als heiligen Berg. Sie nennen ihn Uluru. Für sie ist er ein wichtiges Symbol ihres Kampfes um Landrechte und das Überleben ihrer uralten Kultur. Heute tobt der Konflikt vor allem darüber, wie man diesen heiligen Felsen am besten respektiert und vor der ständig wachsenden Touristenschar schützt.Der Film zeigt die Entwicklung des Berges mit Hilfe modernster 3D-Computeranimation. Indem er diese mit aktuellen Aufnahmen kombiniert, werden historische Prozesse, die Jahrmillionen dauerten, in Sekundenschnelle verdeutlicht. Rekonstruktionen früherer Expeditionen lassen die Besessenheit erkennen, mit denen nach diesem Berg gesucht wurde, der lange Zeit nur aus Legenden bekannt war. Zusammen mit Vertretern von Ureinwohnern, deren Stämme hier seit Urzeiten siedeln, gelingt es dem Team, die einzigartige Fauna und Flora, die sich um den Berg herum ausgebreitet hat, zu dokumentieren. (Text: SWR) Die Azoren – Grünes Paradies im Atlantik
45 Min.Wasserfälle auf der Insel Flores.Bild: NDR/planetfilm/Frederico FournierMitten im Atlantik schlummert ein grünes Paradies – die Azoren. Neun Inseln vulkanischen Ursprungs zwischen Europa und Amerika. Eine faszinierende Pflanzen- und Tierwelt über und unter Wasser. Ein grüner Garten Eden mit exotischer Blütenpracht, der immer noch ein Geheimtipp unter Reisenden und bislang vom Massentourismus verschont geblieben ist. Auf dem zu Portugal gehörenden Archipel befindet sich der höchste Berg des Landes, der Pico, ein erloschener Vulkan. Einige der rund 1.700 Vulkane der Azoren sind immer noch aktiv.Ihr Nationalgericht „Cozido“ schmoren die Bewohner wie in vergangenen Zeiten in der Hitze der Vulkane. An den immergrünen Hängen der erkalteten Vulkane grasen die schönsten Kühe des Atlantik und dort befindet sich Europas einzige Teeplantage. Das Filmteam geht auf den Azoren auf Entdeckungsreise und trifft Abenteurer, Jungbauern und Forscher. Darunter die Meeresbiologin Maria Ines Pavao, deren Vorfahren vor 500 Jahren als eine der ersten Siedler vom Festland Portugals auf die Azoren kamen. Zusammen mit ihrem Kollegen Andre Pacheco, der von Land aus als Walbeobachter arbeitet, ist sie vor der Hauptinsel der Azoren, Sao Miguel, auf der Suche nach den Delfinen und Walen der Azoren. An den Ausläufern des Pico stehen geheimnisvolle Pyramiden, deren Geschichte noch nicht erforscht ist. Der azorische Forscher Prof. Dr. Felix Rodrigues versucht, einige der Geheimnisse der azorischen Pyramiden zu entschlüsseln. Bislang ging man davon aus, dass die Azoren 1427 von portugiesischen Seefahrern entdeckt wurden. Der Forscher findet in den Pyramiden Hinweise, die auf eine viel frühere Besiedelung schließen lassen. Die neben der Insel Pico gelegenen Insel Faial ist ein Treffpunkt für Weltumsegler und Abenteurer. Einer von ihnen ist Bryan Eaton, der sich mit einem zum Flugzeug umgebauten Schlauchboot das erste Mal in die Luft wagt. Das Wetter auf den Azoren ist dabei unvorhersehbar: Statt des allbekannten „Azorenhochs“ sind auf den Azoren heftige Wetterwechsel an der Tagesordnung. Ohne den vielen Regen gäbe es nicht diese spektakuläre Naturkulisse. Das Archipel bildete sich aus Vulkanen, die sich über das Meer erhoben, als vor rund acht Millionen Jahren die eurasische und die amerikanische Kontinentalplatte aufeinanderstießen. Politisch zu Portugal und Europa gehörend, liegen die westlichsten Inseln des Archipels bereits auf der amerikanischen Kontinentalplatte. Rund 1.300 verschiedene Pflanzenarten finden sich auf den Azoren. Darunter Farne so groß wie Bäume. Und: doppelt so viele Kühe wie Menschen! Die beiden Jungbauern Henrique Lourenco und Joao Couto sind auf den Inseln bekannt für ihre besonders schönen Tiere: Bereits mehrere Male hat Joao mit seinen Tieren den Titel „schönste Kuh der Azoren“ geholt. Auch Martim Cymbron nutzt die grünen Felder für sich – als Maler. Er setzt besonders die Farben Grün und Blau, die typischen Farben der Azoren, ein. Sein neuestes Werk hält die bekannteste Blume der Azoren fest, die Hortensie. Dabei kommt diese gar nicht von den Azoren, sondern aus Asien. (Text: NDR) Azoren – Oasen im Atlantik
Der Bootsbauer Joao Silvera Tavares und der ehemalige Fischer Manuel Homem da Silva schwärmen von ihrer Heimatinsel Pico, eine der neun Inseln der Azoren: „Wie dieses Land duftet! Wenn die Trauben reif sind und eine leichte Brise vom Meer weht, dann riecht man die Weintrauben.“ Picos Wein war im 19. Jahrhundert so berühmt, dass selbst der russische Zar ihn im Keller hatte. Die Azoren sind auch Sehnsuchtsziel vieler Auswanderer. Die deutsche Meeresbiologin Mara Schmiing lebt seit sieben Jahren in Horta, der Hauptstadt der Insel Faial. Ihr hat es die faszinierende Unterwasserwelt der Inseln angetan und besonders die entspannte Lebensart. In den letzten Jahren kommen deutlich mehr Touristen, vor allem Wanderer und Vogelbeobachter. Sie alle besuchen die Vulkaninseln, um die Stille der fast unberührten Natur zu genießen. (Text: BR Fernsehen)Bärengeschichten aus Alaska
Deutsche TV-Premiere Sa. 13.11.1982 S3 von Eugen R. EssigDie Bahamas – Farbenfrohe Inselwelt
Wer denkt bei den Bahamas nicht an kilometerlange Sandstrände, türkisfarbenes Meer und strahlend blauen Himmel? Die Inselwelt am Nordrand der Karibik wird ihrem Ruf sicherlich gerecht – und doch gibt es sehr viel mehr zu entdecken. In Nassau, auf der Hauptinsel New Providence, begleitet der Film das bekannte Künstlertrio Beadle/Burnside/Beadle durch seine Heimatstadt und wirft einen Blick auf das Leben der Promis an den Stränden von Paradise Island. Die einzige Zigarrenfabrik der Bahamas steht unter der Aufsicht des ehemaligen Zigarrendrehers von Fidel Castro. Einer der renommiertesten Haiforscher der Welt betreibt seine Studien ganz im Norden auf Walker’s Cay. Nach einer Exkursion ins unberührte Hinterland von Andros beendet der Film die Reise mit dem Besuch eines stimmungsvollen Gottesdienstes auf Grand Bahama. (Text: hr-fernsehen)Die Balearischen Inseln (1): Mallorca und Menorca
„Die balearischen Inseln“ zeigt die spanischen Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera von ihrer schönsten Seite. Kilometerlange Sandstrände, einsame Gebirgszüge und eine vielerorts noch ursprüngliche Inselkultur machen sie zu Sehnsuchtsorten. Im Mittelpunkt der Filme stehen katalanische Lebensart und jahrhunderte alte Traditionen – die unbekannten Seiten der Balearen. Zudem zeigen Flugaufnahmen die Inseln aus einer besonderen Perspektive. Mallorca und Menorca werden oft mit zwei ungleichen Schwestern verglichen: Die eine schillernd und spektakulär, die andere zurückhaltend und charmant.Eines jedoch haben beide gemeinsam: Mallorquiner und Menorquiner zeigen sich unbeeindruckt vom Tourismus und legen großen Wert auf ihre katalanische Identität. In Petra, einem malerischen Ort mit Häusern aus goldbraunem Bruchstein, übt die zehnjährige Margalida den „Ball de bot“, einen alten balearischen Volkstanz. Die Trachten sind selbst genäht, die Musik wird auf traditionellen Instrumenten gespielt, doch haftet dem „Ball de bot“ nichts Verstaubtes an. Er ist für jede Generation von Mallorquinern wieder frisch und modern. Die Familie Gordiola fertigt in ihrer Glasbläserei noch jedes Stück nach altem Verfahren an. Der junge Glasbläser Pep zaubert nach über zehn Jahren Lehre heute kunstvolle Vasen, Gläser und Figuren. Im Gebirge „Serra de Tramuntana“ verfüttert der Tierschützer Juan José Sánchez ein verendetes Schaf an Mönchsgeier. Die beeindruckenden Vögel sind vom Aussterben bedroht, die letzte Inselpopulation der Welt lebt auf Mallorca. Für die junge Extremsportlerin Katiana Torrebella sind die steilen, einsamen Straßen des Gebirges ideale Trainingsstrecken: Im Winter brettert sie mit über 50 Sachen auf einem überlangen Skateboard die Serpentinen hinab. Auf Menorca ist ein Archäologenteam bei der Arbeit – an Land und unter Wasser. Die Insel wurde im Laufe der Geschichte immer wieder von wechselnden Kulturen erobert ist somit ein Eldorado für Altertumsforscher wie Fernando Contreras. Der Film begleitet ihn und seine Mitarbeiter bei der Freilegung einer römischen Basilika und einer frühchristlichen Grabstätte. Heute ist die Pferdezucht der vielleicht größte Schatz Menorcas. Das Gestüt der Familie Marques hat mit seinen Dressurpferden viele internationale Preise gewonnen. Vater und Tochter genießen jedoch am meisten den Ausritt auf dem „Camí de Cavalls“, einem alten Patrouillenweg, der rund um die Insel führt. (Text: SWR) Die Balearischen Inseln (2): Ibiza und Formentera – Inseln der Glückseligkeiten
Bis in die 1960er-Jahre galten die beiden Inseln Ibiza und Formentera als arm und rückständig. Dann entdeckten die Hippies ihre Schönheit. Ibiza hat sich seither zu einem weltbekannten Party-Hotspot entwickelt, mit angesagten Clubs und DJs, die einen eigenen Musikstil entwickelt haben, den Balearic Sound. DJ Pippi hat seit den 1980er-Jahren den Ibiza-Stil mitgeprägt. In seinem Studio und an den Turntables der Strandbars zeigt er, was den Balearic Sound ausmacht: die entspannte Mischung aus Dancehall- und Flamencomusik, der Soundtrack zu Ibizas Sonnenuntergängen. Die Insel gilt als Treffpunkt der High Society: In den Marinas liegen die Luxusjachten dicht an dicht.Gegen die Langeweile der Reichen weiß Frédéric Sciamma Abhilfe. Der Franzose verkauft verrückte Wassersportgeräte wie das Flyboard, das seine Kunden wie Superman über das Meer fliegen lässt. Die Einheimischen auf Ibiza lassen sich vom Partytrubel nicht aus der Ruhe bringen. Vincent Palermet schichtet wie schon sein Vater und Großvater in der sengenden Hitze Ibizas typische Trockenmauern Stein für Stein aufeinander. Die archaischen Terrassenbauten kommen ohne Mörtel aus. Auf den kargen Böden erzeugen sie ein fruchtbares Mikroklima. Formentera ist die kleinste bewohnte Baleareninsel. Da es dort keinen Flughafen gibt, sind die Urlaubermassen an den karibisch anmutenden Stränden bisher ausgeblieben. Das Geheimnis des tiefblauen Wassers heißt Posidonia oceanica. Die riesige Wasserpflanze verteilt sich quadratkilometergroß über den Meeresboden und filtert das Wasser. Über Formentera weht noch immer der Geist der 1960er-Jahre, auch in Ecki Hoffmanns Gitarrenwerkstatt. In nur drei Wochen bringt er Rockfans bei, eine E-Gitarre zu bauen. Botanikerin Barbara Klahr geht auf Orchideensuche. Und Vespa-Verleiherin Carmen Rosello erzählt, warum Formentera immer italienischer wird. (Text: NDR) Die Balearischen Inseln: Mallorca und Menorca
Die Baleareninseln Mallorca und Menorca sind nach wie vor beliebte Reiseziele. Die Mallorquiner und Menorquiner ficht das nicht an. Sie verteidigen hartnäckig ihre katalanische Identität. So sind auf den Inseln trotz des Massentourismus jahrhundertealte Traditionen wie der balearische Volkstanz „Ball de bot“ weiterhin lebendig. Und zahlreiche Ausgrabungsstätten belegen eine lebhafte Vergangenheit. (Text: SWR)Deutsche TV-Premiere So. 21.07.2013 SWR Fernsehen Die Ballade vom Baikalsee – Sommerreise
Die „Perle Sibiriens“, der „Brunnen des Planeten“, das „Heilige Meer“ – viele Namen haben die Sibiriaker ihrem geliebten Baikalsee gegeben, dem größten Süßwassersee Eurasiens und einem der tiefsten, schönsten und geheimnisvollsten Seen der Welt. Klaus Bednarz, der ehemalige Russland-Korrespondent der ARD, hat den Baikalsee im Sommer besucht. Ob mit spiegelglatter Oberfläche oder wenn sich das Gewässer innerhalb von Sekunden in ein tobendes Meer verwandelt – wer immer den See gesehen hat, wird von seinem Zauber gefesselt. Und immer wieder begegnet Klaus Bednarz Menschen: Fischern, Zechern bei einer russisch-mongolischen Hochzeit, Russen, die gekommen waren, um die Transsibirische Eisenbahn zu bauen, die aber blieben, weil der „See ihr Herz gefangen hat“. Dasselbe könnte auch mit den Zuschauern geschehen, wenn sie diese eindrucksvolle Dokumentation gesehen haben. (Text: WDR)Bama, der Gorillamann – Abenteuer in Kamerun
Einem Fernsehteam gelingt es zum ersten Mal, Fernsehaufnahmen des seltensten Menschenaffen der Welt zu machen. Nie zuvor konnten Cross River Gorillas – eine seltene Unterart des Westlichen Flachlandgorillas – gefilmt werden. Der Dreh für ‚Bama der Gorillamann‘ stand unter ungewöhnlichen Vorzeichen für einen Naturfilm. Nur wenige Wochen lagen zwischen der Idee des Films und Drehbeginn. Nach einer kurzen Recherchereise brechen die Filmer Ernst Sasse und Hans-Peter Kuttler nach Kamerun auf, um über die seltenen Menschenaffen zu berichten. Begleitet werden die beiden von der britischen Autorin und Regisseurin Nicky Lankester. Vor Ort trifft das Filmteam auf Gorillapfleger Alfred Bama – von allen nur Bama genannt.Der charismatische Mann hat ein besonderes Händchen im Umgang mit den Tieren und fasziniert die Filmer. So beschließt das Team, sich gemeinsam mit Bama im dichten Regenwald Kameruns auf die Suche nach den letzten Cross River Gorillas zu begeben. Bereits elf Fernsehteams vor ihnen hatten versucht, die letzten noch lebenden Cross River Gorillas vor die Kamera zu bekommen. Vergeblich. Um so höher die Anspannung, ob es diesmal gelingen wird. Doch dann ist die Sensation pefekt: Ernst Sasse und Hans-Peter Kuttler werden auf einer der anstrengendsten und schwierigsten Drehreisen ihres Lebens mit einmaligen Bildern belohnt. (Text: EinsPlus) Bambus
Die Augen fest auf den Boden gerichtet durchkämmt Hu Zhongbao seinen Bambushain. Er sucht Bambussprossen. Hu Zhongbao ist Bambusbauer in der Provinz Zhejiang. Heute Abend will er die Delikatesse zubereiten und sich so bei seinen Nachbarn für die Erntehilfe bedanken. Den ganzen Tag über hat Bauer Hu mit ihnen den Maozhu geschlagen, mehr als eine Tonne Stangen ins Tal geschleppt. Seit mehr als 4.000 Jahren leben die Menschen südwestlich von Shanghai von und mit dem Bambus. In keiner Region Chinas wird mehr geerntet. Botanisch betrachtet ist Bambus ein Gras – und eben kein Holz, wie zu vermuten wäre.Keine Pflanze ist weiter verbreitet, und keine wächst schneller als das Riesengras. Seitdem die tropischen Regenwälder mit ihren edlen Hölzern mehr und mehr bedroht sind, haben Europäer und Amerikaner den Bambus als schnell nachwachsenden Rohstoff für sich entdeckt, ökologisch unbedenklich und mit Eigenschaften, die sonst nur Kunststoffe oder Stahl aufweisen. So verwundert es nicht, dass die Nachfrage nach Bambus von Jahr zu Jahr steigt. Die Bambusstangen sind Grundlage für Matten, Rollos, Parkett und Hausgeräte aller Art. Die Dokumentation gibt einen Einblick in das Leben der Bambusbauern. Sie zeigt die Ernte ebenso wie die vielfältige Verarbeitung des Bambus in China. Dabei werden auch die Grenzen des Wachstums einer am Bambus orientierten Landwirtschaft deutlich. Mittels Genmanipulation und künstlichem Dünger wollen Wissenschaftler seine Effizienz weiter steigern. Neben dem hohen Gebrauchswert von Bambus als Baustoff und Nahrungsmittel vermittelt der Film aber auch eine Ahnung von der Schönheit und ästhetischen Anmut des Wundergrases. (Text: hr-fernsehen) Die Bambusflößer von Bangladesch: Folge 1
Der Zweiteiler berichtet über den Handel mit Bambus, dem Baustoff der Armen. Mit atemberaubenden Aufnahmen von Bangladeschs Bambuswäldern führt der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmer Shaheen Dill-Riaz in die raue Welt der Männer ein, die den Bambus aus dem Wald holen und für Großhändler über eine 300 Kilometer lange Flussstrecke Richtung Dhaka, der Landeshauptstadt, flößen. Der Film führt in die Tropenwälder im Nordosten Bangladeschs. Für so manchen Tagelöhner, der hier den Bambus schlägt, entpuppt sich der grüne Dschungel als heimtückischer Ort, in dem sogar Geister hausen. So erzählt es der Vorarbeiter Liakot, der für das Wohl und die Nöte mehrerer Dutzend Männer verantwortlich ist.Seit fast 30 Jahren ist er dabei, als kleiner Junge schon von seinem Vater ins Handwerk eingeführt. Mit seinen Leuten fällt Liakot Jahr für Jahr ungezählte Halme, hebt Kanäle aus, baut Dämme, um das Bergwasser zu stauen und den Bambus damit ins Tal zu schiffen. Am Fluss warten Flößer, die das Holz weitertransportieren. Zunächst jedoch müssen sie die Bambusstangen bündeln und in tagelanger Arbeit zu einem riesigen Floß zusammensetzen. Auf dem Floß werden sie in den nächsten vier Wochen Tag und Nacht verbringen. „Toilette, Badezimmer, Waschküche, alles in einem. Mit dem Wasser kochen wir auch“, erzählt einer der Männer und zeigt grinsend in die braunen Fluten. 300 Kilometer Floßgemeinschaft: Piraten und korrupte Polizisten gehören als unwillkommene Besucher dazu. Ob im Wald oder auf dem Wasser, die Wanderarbeiter und Tagelöhner eint, dass der Bambus sie von zu Hause fortlockt, von den Sorgen ihrer Frauen, mit denen sie, als sie fast noch Kinder waren, verheiratet wurden. Manche wollten sich entziehen, doch die Tradition und der soziale Druck waren mächtiger. So sind das Floß und der Wald ihr zweites Zuhause, ihre Zuflucht, geworden. (Text: BR Fernsehen) Die Bambusflößer von Bangladesch: Folge 2
Barcelona – Die stolze Katalanin
Nach Paris ist Barcelona die am dichtesten besiedelte Metropole Europas. Hinzu kommen jährlich mehr als sieben Millionen Touristen. Was macht die Hauptstadt Kataloniens zur Kultmetropole? Ilka Franzmann begegnet Menschen, die Kataloniens Hauptstadt ihr Gesicht geben und für ihr Lebensgefühl stehen. Der stetige Wandel Barcelonas wird an der Sagrada Familia sichtbar. Seit mehr als 130 Jahren wird an Antoni Gaudís Basilika gebaut. Die Architektin Marta Miralpeix und ihr Team rücken nun die Vollendung des Kunstwerks in greifbare Nähe. Zu Gaudís 100. Todestag im Jahr 2026 soll, dank neuer Technologien, das Bauwerk fertig sein. Am langen Stadtstrand von Barceloneta füllt der französische Zeichner Lapin sein Skizzenbuch.Er hat Barcelona zu seiner Wahlheimat auserkoren und trifft auf seinen Streifzügen auf alteingesessene Barcelonesen und ihr Wissen um die Stadt. Leben hieß in Barcelona jahrhundertelang immer auch Überleben im Kampf gegen Invasoren, lähmende Handelseinschränkungen und „staatliches Mobbing“ durch das zentralistische Madrid. So zumindest erzählen es die „Castellers“ aus dem Viertel Poble-Nou, die die Filmautorin bei ihren Vorbereitungen zum Menschen-Turmbau-Wettbewerb begleitet. Der Künstler Jorge Gerada rüttelt mit seinen Aktionen an Tabus. Mit Spraydosen beamt er ein überdimensional großes Foto aus dem Bürgerkrieg auf das Pflaster der Innenstadt, um die Vergangenheit lebendig zu halten. In der Ideenschmiede „Fablab“ will Anastasia Pistofidou die künstliche Intelligenz von Stoffen vorantreiben. Ihr neuer Bodysuit misst die Muskelspannung einer Tänzerin und übersetzt ihre Bewegung in Musik. „Für mich ist das Meer wie ein Reisebüro. Es hat mein Leben verändert und mich dahin gebracht, wo ich heute bin“, sagt der ehemalige Flüchtling Soly Malamine. Barcelona wurde für ihn zum rettenden Hafen. Heute ist der Senegalese Chef eines Restaurants, das Flüchtlinge für die Gastronomie ausbildet. (Text: BR Fernsehen)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail