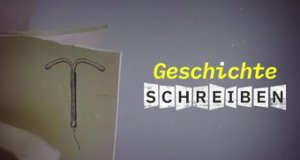bisher 65 Folgen, Folge 45–65
45. Die Brille – Wissen ist Macht
Folge 45 (16 Min.)Selbst der schönste Text verliert seinen Reiz, wenn man die Buchstaben nicht mehr erkennen kann. Daher war die Entwicklung der Brille von großer Bedeutung für die Geschichte des Lesens, der Darstellung und des Wissens. Die Historikerin und Expertin für mittelalterliche Schriftkultur Claire Angotti zeigt auf, wie aus dem mittelalterlichen Lesestein die moderne Brille entwickelt wurde und sich das „Lesegestell“ im Lauf der Zeit mit verschiedensten Bedeutungen auflud. Die sogenannten Niet- oder Nagelbrillen des Mittelalters bestanden aus zwei Gläsern, die von einem Nagel zusammengehalten wurden. Daneben verwendeten Mönche auch Lesesteine als Lupen, wenn die Sehkraft nachließ.
Dazu nutzte man klare geschliffene Kristalle, Berylle – aus denen sich die spätere Bezeichnung „Brille“ ableitete. Mit dem Aufblühen der Universitäten und Bibliotheken und der Einführung des Papiers in Europa entsteht die Kategorie der Intellektuellen und die Brille wird sowohl zum wichtigen Accessoire im Alltag als auch zum sozialen und symbolischen Marker. Nach und nach demokratisiert sich das Lesegestell und immer mehr soziale Gruppen tragen es, um schärfer zu sehen – etwa Notare, Ärzte und Händler. Am Ende des Mittelalters tragen jene Menschen eine Brille, die in der Gesellschaft eine gewisse Autorität verkörpern, das Tragen der Brille wird zum Kennzeichen von Wissen und Macht. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 07.05.2022 arte Deutsche Online-Premiere Sa 30.04.2022 arte.tv Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 28.05.202246. Hausgötter im alten Rom – Big Brother der Antike?
Folge 46 (16 Min.)Sie sollten das Heim römischer Bürgerinnen und Bürger vor Unheil bewahren: Laren und Penaten, die Schutzgeister der Familie. Um die Hausgötter um ihr Wohlwollen zu bitten, betete die Familie täglich vor einem Hausschrein, dem sogenannten Lararium. Neben den privaten Hausgöttern gab es auch „Lares publici“, die ganze Orte, Plätze und Wegkreuzungen schützen sollten. Wo früher Schutzgötter wachten, finden sich heute Videoüberwachungssysteme – Zufall oder moderner Ausdruck eines Urbedürfnisses? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 14.05.2022 arte Deutsche Online-Premiere Sa 07.05.2022 arte.tv 47. Die mechanische Ente – Automatenkunst im 18. Jahrhundert
Folge 47 (16 Min.)Sie gilt als Wegbereiterin der Robotik und faszinierendes Beispiel des Experimentierens mit Automaten im 18. Jahrhundert: die mechanische Ente, eine Erfindung des französischen Ingenieurs Jacques Vaucanson aus dem Jahr 1738. Was machte diese Ente so besonders? Und in welchem Maße erschließen uns künstliche Maschinen intellektuellen Fortschritt? Die Historikerin Mélanie Traversier gibt Einblicke in die abenteuerliche Geschichte und die Funktionsweise dieses Automaten. Schon lange vor dem 18. Jahrhundert tauchen menschen- oder tierähnliche Automaten in der Geschichte auf.
Auch der junge Jacques Vaucanson, 1709 in Grenoble als Sohn eines Handschuhmachers geboren, ist von der Mechanisierung und ihrer langen Tradition fasziniert. Seine Automaten stehen in engem Zusammenhang zu der Begeisterung für technische Innovation und mechanischen Fortschritt im 18. Jahrhundert. Vaucanson beginnt Anfang der 1730er mit der Konstruktion erster Automaten und wird ab 1738 durch eine Ausstellung dreier seiner Exemplare in Paris schlagartig berühmt: Neben einem automatischen Flötenspieler und einen Trommler stand vor allem die Ente bald im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und faszinierte Wissenschaftler und Laien im In- und Ausland.
„Die mechanische Ente“, schrieb Edgar Allan Poe später in seinem Roman „Maelzels Schachspieler“, „imitierte so perfekt das lebende Tier, dass sich alle Zuschauer der Illusion hingaben.“ Sie war lebensgroß und wurde mittels eines Aufziehmechanismus aktiviert. Zahnräder in ihrem Innern bewegten Hals und Schnabel. Wenn man Körner vor sie hinlegte, konnte die Ente sie aufpicken und sogar vermeintlich verdauen, ein Mechanismus, der auf einer Illusion beruhte, denn die „Exkremente“ wurden zuvor im Enten-Körper deponiert und bei Aktivierung „ausgeschieden“.
Besonders angetan waren die Betrachter von der Tatsache, dass man diesen „Verdauungsprozess“ im Innern durch seitliche Öffnungen verfolgen konnte. Bis weit ins 19. Jahrhundert zieht die mechanische Ente die Menschen in ihren Bann, bevor sich nach dem 19. Jahrhundert die Faszination für Automaten und Androiden erstmals mit Unbehagen mischt. Wird sich der Maschinen-Mensch eines Tages von der humanisierten Mechanik beherrschen lassen? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Mo 16.05.2022 arte Deutsche Online-Premiere Sa 14.05.2022 arte.tv Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 21.05.202248. „Die große Welle“ von Hokusai – Vom Holzschnitt zur globalen Ikone
Folge 48 (16 Min.)„Die große Welle vor Kanagawa“ ist der Titel des berühmten Farbholzschnitts des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai. Hokusai, der knapp 90 Jahre alt wurde, fertigte diesen Holzschnitt im Alter von 70 Jahren an. Die große Welle von Hokusai ist der bekannteste japanische Druck und gehört zu den berühmtesten graphischen Werken der Welt. Das Bild zeigt drei Boote in einer Welle vor der Küste Kanagawas und vor der Kulisse des Berges Fuji. Das dunkelblaue Wasser der turbulenten See umschließt die zerbrechlichen Boote, die das Wellental durchqueren.
Wie konnte dieser Holzschnitt aus den 1830er Jahren, entstanden im zu jener Zeit von der europäischen Globalisierung abgewandten Japan, zur universellen Ikone werden? Die Dokumentation erzählt die Entstehungsgeschichte eines immer wieder aufgegriffenen Motivs, in dem das von Hokusai verwendete „Berliner Blau“ der Welle eine zentrale Rolle spielt. Das Bild gilt als eines der weltweit bekanntesten Werke der japanischen Kunst. Es wurde in zahlreichen Nachbildungen immer wieder rezipiert, insbesondere im europäischen Jugendstil. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 28.05.2022 arte Deutsche Online-Premiere Sa 21.05.2022 arte.tv Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 07.05.202249. Die Tyrannenmörder – Ein Denkmal der Demokratie?
Folge 49 (16 Min.)Die Geschichte der attischen Demokratie ließ sich an Monumenten ablesen, die heute größtenteils nicht mehr erhalten sind. So auch die antike Statuengruppe der „Tyrannenmörder“ Harmodios und Aristogeiton, die im 5. Jahrhundert vor Christus als Denkmal für den Sieg der Demokratie über die Tyrannei auf der Agora von Athen aufgestellt wurde. Das Motiv wurde auch auf griechischen Vasen, Münzen und Reliefs übernommen und fand viele Nachahmer. Historiker Vincent Azoulay erklärt, wie die Darstellung der Tyrannenmörder sich im Laufe der Jahrhunderte wandelte – bis hin zur umstrittensten aller zeitgenössischen Monumentalskulpturen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 04.06.2022 arte Deutsche Online-Premiere Sa 28.05.2022 arte.tv 50. Die Kamelie – Blume der Freiheit
Folge 50 (17 Min.)Blume des Theaters, der Freiheit und des zivilen Ungehorsams: Die weiße Kamelie blühte zunächst in den Quilombos, den Zufluchtsorten für Sklaven – und wird Mitte der 1880er Jahre in Brasilien zum Symbol der Abschaffung der Sklaverei. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 17.06.2022 arte 51. Das Wahlgeheimnis
Folge 51 (15 Min.)Reicht es aus, das Wahlrecht zu haben, um frei wählen zu können? In der Tat war Wählen lange Zeit eine kollektive Handlung und aufgrund des öffentlichen oder gar ostentativen Charakters des Urnengangs der sozialen Kontrolle unterworfen. Die Geschichte der freien Wahl ist an einen besonderen Gegenstand geknüpft: die Wahlkabine. Erst sie legitimiert das Wählen als persönlichen und „geheimen“ politischen Akt. Indem sie das Wahlgeheimnis garantiert, sichert sie auch das öffentliche Wohl und die Demokratie. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 23.09.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 16.09.2022 arte.tv 52. Die Abschaffung der Nacht
Folge 52 (15 Min.)Schneller, lauter, heller: In einer Zeit, in der Lichtverschmutzung und Lärm den Menschen den Schlaf rauben, scheint der Wunsch, die Nacht abzuschaffen, verwunderlich. Im Zeitalter der Aufklärung war genau das aber gewollt: Die Straßen Europas waren auf einmal von Laternen gesäumt, die Sperrstunde wurde abgeschafft, und nach dem Vorbild der Königshöfe florierte bald in den Städten das Nachtleben. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 30.09.2022 arte 53. Oluale Kossola, Erinnerungen eines Sklaven
Folge 53 (16 Min.)Nach Beginn des Kolonialismus wurden über zwölf Millionen Frauen, Männer und Kinder von Afrika nach Amerika verschleppt. Ob Dokumente von Sklavenhändlern, Sklavereigegnern oder ehemaligen Sklaven: Anhand der Archive, die den transatlantischen Sklavenhandel nachzeichnen, gewinnen Historiker nicht nur Erkenntnisse über die großen Zahlen und Fakten dieses grausamen Teils der Geschichte, sondern auch ein recht realistisches Bild von zahlreichen Einzelschicksalen der gegen ihren Willen versklavten Afrikaner. Zu Gast bei Patrick Boucheron erzählt Kolonialhistorikerin Cécile Vidal das Schicksal Oluale Kossolas, der im Jahr 1860 als einer der letzten Afrikaner über die Mittlere Passage nach Amerika verschleppt wurde. Kossolas Zeugnis ging vor allem durch Filmaufnahmen eines Interviews der afroamerikanischen Anthropologin Zora Neale Hurston mit dem Überlebenden in die Geschichte ein. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 07.10.2022 arte 54. Kalaschnikow, der Siegeszug der AK-47
Folge 54 (15 Min.)Mehr noch als die Atombombe hat die Kalaschnikow in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Kriegsgeschichte geschrieben. Während des Kalten Krieges wurde das leicht zu bedienende sowjetische Sturmgewehr zum Symbol von Guerillakämpfen und antikolonialen Befreiungsbewegungen. Später bemächtigten sich Gangs, Terroristen, Amokläufer und gescheiterte Staaten der AK-47. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 14.10.2022 arte 55. Die Treibhäuser des Kolonialismus
Folge 55 (16 Min.)Bei der Kolonialisierung der Welt machten die Europäer auch vor Pflanzen nicht Halt: Sie wurden gesammelt, verschifft, gekreuzt, akklimatisiert und im Dienste von Wirtschaft, Wissenschaft und Kolonialprestige ausgebeutet. Eine zentrale Rolle in diesem System spielten botanische Gärten, zum Beispiel der von Kalkutta. In diesem Mikrokosmos der Kolonialherrschaft hegten und pflegten indische Kulis einen majestätischen Baum, in dem die Briten ihr ganzes Empire verkörpert sahen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 21.10.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 14.10.2022 arte.tv 56. Das Palästinensertuch – Mehr als ein Stück Stoff
Folge 56 (15 Min.)Seit dem 20. Jahrhundert ist der israelisch-palästinensische Konflikt ein Dauerthema im Nahen Osten. In der Geschichte spielt ein einfaches Stück Stoff eine wichtige Rolle: die Kufija, besser bekannt als „Palästinensertuch“. Während des Arabischen Aufstands 1936 wurde die traditionelle Kopfbedeckung der palästinensischen Bauern zu einem Symbol des Widerstands. Im Zuge des Nahostkonflikts verbreitete das Tuch sich als Zeichen der Solidarität mit den Palästinensern in ganz Europa, bevor es zu einem reinen Modeaccessoire wurde. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 28.10.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 21.10.2022 arte.tv 57. Die Peitsche, zwischen Sünde und Genuss
Folge 57 (16 Min.)Wer sündigt, der züchtigt sich … Die Peitsche als Instrument der Disziplinierung und Buße rückte mit den mittelalterlichen Geißlerumzügen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die sogenannte Flagellation war eine Vergegenwärtigung des Leidens Christi und zugleich ein Reinigungsritual. Die Selbstgeißelung sollte böse Leidenschaften bekämpfen, aber den sündigen Menschen auch erneuern und geistig erhöhen. Erzieherische Gründe dienten bis weit ins 20. Jahrhundert auch zur Rechtfertigung körperlicher Züchtigung von Kindern und Jugendlichen. Spätestens mit dem Marquis de Sade bekam die Peitsche zudem einen erotischen Anstrich, und der mit Schmerzen verbundene Lustgewinn entwickelte sich zu einer eigenen Sexualpraktik. Die Geschichte der Peitsche – zwischen Sünde und Genuss. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 04.11.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 28.10.2022 arte.tv 58. Die Erfindung des Frühstücks
Folge 58 (16 Min.)Das Frühstück, „Breakfast“ oder „Petit déjeuner“, wie wir es kennen, ist eine eher junge Erfindung und existiert tatsächlich erst seit der Einfuhr exotischer Heißgetränke aus anderen Kontinenten in das Europa des 18. Jahrhunderts. Vom Morgenkaffee bis hin zum Gefäß, aus dem er getrunken wird: Die Geschichte unseres Frühstücks ist die von Entdeckungsreisen und Welthandel. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 11.11.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 04.11.2022 arte.tv 59. Homers Epos, Popkultur der Antike
Folge 59 (15 Min.)Gab es Troja wirklich? Heinrich Schliemann und weitere Archäologen des 19. Jahrhunderts waren überzeugt davon und begannen mit den Ausgrabungen am vermeintlichen Schauplatz von Homers Ilias und Odyssee. Sie sollten Recht behalten: Neben der verschollenen Stadt Troja entdeckten die Forscher eine homerische Kultur, die über die bis dato überlieferten Texte hinausging. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 18.11.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 11.11.2022 arte.tv 60. Partnervermittlung, von der Kupplerin zum digitalen Match
Folge 60 (16 Min.)Im Mittelpunkt der von dem französischen Mittelalter- und Renaissancespezialisten Patrick Boucheron präsentierten Sendung steht die Frage: Was hat uns Geschichte heute zu sagen? Jede Woche stellt ein Gast einen Gegenstand und seine Geschichte vor. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 25.11.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 18.11.2022 arte.tv 61. Römer gegen „Barbaren“, Konstruktion einer Legende
Folge 61 (16 Min.)Der Geschichtsunterricht datiert den Untergang des Weströmischen Reichs auf das Jahr 476 n.Chr. In dieser Zeit wird auch der Übergang von der Antike ins Mittelalter angesiedelt. Grund für diesen historischen Wendepunkt soll die Völkerwanderung gewesen sein … Zu Gast in der Sendung: Historiker Giusto Traina (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 02.12.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 25.11.2022 arte.tv 62. Der Zoo, ein Leben hinter Gittern
Folge 62 (15 Min.)Als wilde Tiere in Käfige gesperrt wurden, damit sie von Besucherinnen und Besuchern in ganz Europa bestaunt werden konnten, erschuf man damit eine ganz eigene Welt hinter Gittern – zwischen Furcht und Faszination. Die Geschichte des Zoos ist aber auch die des Verhältnisses zwischen Mensch und Tier, eine Geschichte des Sehens und Gesehenwerdens – die 1907 im Hamburger Tierpark Hagenbeck beginnt. Der Historiker Eric Baraty, heute zu Gast bei Patrick Boucheron, ist Autor eines Buches, in dem er die Geschichte des Zoos aus der Perspektive der eingesperrten Tiere betrachtet. Wie fühlt sich ein solches Leben hinter Gittern an? Das Ausstellen wilder, exotischer Tiere ist zudem eng mit der Kolonialgeschichte verbunden. Im Zuge derer konnten Tiere aus fremden Ländern als Objekte in zoologischen Gärten oder bei Weltausstellungen zur Schau gestellt und einem neugierigen Publikum präsentiert werden. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 09.12.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 02.12.2022 arte.tv 63. Von der Pest bis Covid-19, die Angst vor der Seuche
Folge 63 (16 Min.)Angefangen bei der Großen Pest über die Spanische Grippe bis hin zur Coronapandemie der Gegenwart: Die Schutzmaske verkörpert wohl seit jeher die Angst vor der Seuche am besten. Aber wie kam es dazu, dass die Maske heute als eine der wirksamsten Waffen im Kampf gegen Pandemien eingesetzt wird? „Geschichte schreiben“ führt die Zuschauerinnen und Zuschauer zurück ins späte 19. Jahrhundert nach China. Dort wütete die dritte Pestpandemie und forderte Millionen Todesopfer. Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen und den internationalen Handelsaustausch aufrechtzuerhalten, musste das Gesundheitssystem modernisiert werden. Dazu zählt die Errichtung von Krankenhäusern, Quarantäneverordnungen, ein globaler Austausch von lebenswichtigen Informationen sowie auch die Weiterentwicklung der Infektionsschutzmaske. Pandemieausbrüche damals wie heute zeigen jedoch: Menschen verhalten sich nicht immer solidarisch und dies führt häufig zu einer Spaltung der Gesellschaft. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 16.12.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 09.12.2022 arte.tv 64. Das Atomzeitalter, zwischen Hoffnung und Gefahr (L’âge nucléaire, l’espérance et la terreur)
Folge 64 (15 Min.)Energiekrise, Klimawandel und Krieg: Das sind nur einige von vielen Herausforderungen, die die Menschheit heute in Alarmbereitschaft versetzen. Eng verbunden mit all diesen Katastrophen ist auch der mögliche Einsatz von Atomkraft – im guten wie im schlechten Sinne. Die Geschichte des nuklearen Zeitalters befasst sich mit Energie und Bedrohung, Hoffnung und Schrecken und verkörpert Utopie und Dystopie zugleich. Zu Gast in dieser Ausgabe von „Geschichte schreiben“ ist die Historikerin Karena Kalmbach.
Als Expertin für Nukleargeschichte skizziert sie deren Entwicklung – angefangen bei physikalischen Meilensteinen bis hin zu den Anti-Atomkraft-Bewegungen der jüngsten Vergangenheit. Sie zeigt, dass das nukleare Zeitalter weit mehr ist als die zerstörerische Kraft der Atombombe oder die Utopien, die mit der zivilen Nutzung der Atomtechnologie verbunden sind. Es steht im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Betrachtungen über die Beziehungen zwischen Mensch und Technologie sowie zwischen Mensch und Umwelt. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 23.12.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 16.12.2022 arte.tv 65. Der Diwan, Staat und Religion im Islam (Le diwan, une Histoire de l’Etat en Islam)
Folge 65 (16 Min.)Das Wort „Diwan“ hat viele verschiedene Bedeutungen: Polsterbank, Gedichtsammlung, Behörde, Ministerialbüro oder Ratsversammlung. Der Begriff steht für vielerlei Dinge und trägt eine Menge Historie in sich. Er erzählt die Geschichte des Islams, einer Religion, aber auch einer politischen Kultur, die über 1.000 Jahre lang ein Reich prägte, das sich vom Maghreb bis in den Nahen Osten erstreckte. Zu Gast bei „Geschichte schreiben“ ist der Historiker Julien Loiseau, ein Experte der islamischen Welt des Mittelalters. Gemeinsam mit ihm geht es bei ARTE auf Spurensuche: vom Harem des Sultans bis zum Ratssaal, vom Sitz des Herrschers bis zum Papierregister offenbart das Wort „Diwan“ unterschiedlichste Etappen der politischen Entwicklung im Islam. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 30.12.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 23.12.2022 arte.tv
zurück
Erinnerungs-Service per
E-Mail