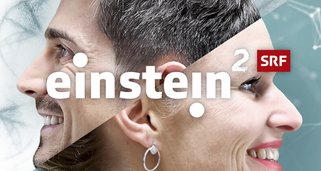2023/2024, Folge 36–59
Faszination Traum – Was unbekannte Personen in deinem Traum bedeuten
Folge 36Träume faszinieren schon seit Jahrtausenden. Für Psychoanalytiker Sigmund Freud sind sie der Königsweg zum Unterbewusstsein. Sprich: In der Nacht kommen die Dinge ans Licht über die man sich am Tag nicht nachzudenken getraut. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 07.09.2023 SRF zwei ChatGPT: Was, wenn Schwarmintelligenz zur Schwarmdummheit wird?
Folge 37ChatGPT sammelt aufgrund unserer Rückmeldung Informationen zu bestimmten Themen. Aber was, wenn die Rückmeldung von den Falschen kommt? Was, wenn Schwarmintelligenz zur Schwarmdummheit wird? (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 14.09.2023 SRF zwei Gefühlsblind: Wie lebt es sich ohne Gefühle?
Folge 38Menschen mit Gefühlsblindheit können Emotionen wie Liebe, Wut oder Angst nicht richtig wahrnehmen. Das steckt hinter «Alexithymie». (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 21.09.2023 SRF zwei Türschwelleneffekt: Wie das Gedächtnis auf einen Zimmerwechsel reagiert
Folge 39Vergesslichkeit gehört zum Leben. Nur: Manchmal ist es tatsächlich die Türschwelle, die Dinge nicht mehr zugänglich macht. Der kommt in den besten Familien – beziehungsweise Wohnungen – vor. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 28.09.2023 SRF zwei PMS: Wenn die Tage vor der Mens zur Qual werden
Folge 40Stimmungsschwankungen, Cravings und Kopfweh – die zweite Zyklushälfte ist für viele Frauen eine echte Herausforderung. Für manche wird sie sogar zur richtigen Qual. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 05.10.2023 SRF zwei Mentaltraining: Helfen Visualisierungen wirklich, innere Blockaden zu überwinden?
Folge 41Tobias Müller macht den Selbstversuch: Schafft er dank Mentaltraining seine Blockade beim Klettern zu überwinden? (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 12.10.2023 SRF zwei Face Matching Effekt: Gleicht das Gesicht dem Vornamen?
Folge 42Laut Forschenden in Israel liegt die Wahrscheinlichkeit bei 35 Prozent, dass Menschen den Namen einer Person aus dem Nichts erraten können – nur durch ihr Gesicht. Aber wie ist das möglich? (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 19.10.2023 SRF zwei Schweizer TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 31.08.2023Was taugen Persönlichkeitstests wirklich?
Folge 43In den sozialen Medien trendet ein Persönlichkeitstest, der davon ausgeht, dass es insgesamt 16 Persönlichkeitstypen gibt. Was sagt die Wissenschaft dazu? (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 26.10.2023 SRF zwei Generation Z im Job: Sind die wirklich so faul, wie alle sagen?
Folge 44Einstein² Keyvisual 2022 SRFBild: SRF1Faul, verwöhnt, fordernd: Das sind gängige Vorurteile, wenn es um die Generation Z in der Arbeitswelt geht. Aber was ist dran? (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 02.11.2023 SRF zwei So wirken Schmerztabletten schneller
Folge 45Kopfschmerzen? Knieprobleme? Schmerzen im Handgelenk? Viele greifen in solchen Momenten zu Schmerzmittel. Doch wie lange es dauert, bis eine Schmerztablette wirkt, hängt von der Körperhaltung ab – das behaupten zumindest Forschende der John-Hopkins-Universität in Baltimore. In ihrer Studie zeigen sie: Legt man sich auf die rechte Seite, geht es zehnmal schneller als auf der linken: 100 Minuten auf der linken, 23 Minuten aufrechtstehend, 10 Min auf der rechten Seite liegend.
Aber woran liegt das? Vor allem am Verdauungssystem: Wie alle Medikamente, die geschluckt werden, müssen auch Schmerztabletten einen weiten Weg zurücklegen, bis der Wirkstoff im Zwölffingerdarm aufgenommen wird. Doch: Je steiler der Winkel, in dem das Medikament durch den Magen rutscht, desto schneller wirkt es. Wenn man auf der rechten Seite liegt, arbeiten Schwerkraft, Magenkontraktionen und Magensaftströmungen perfekt zusammen. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 09.11.2023 SRF zwei Girl Math Trend: Wie Kaufsucht in den Sozialen Medien genannt wird
Folge 46Es klingt harmlos: Auf TikTok rechtfertigen junge Frauen ihre Käufe mit wilden Berechnungen: Das teure Styling-Tool für die Haare, das bestellt wurde, sorgt dafür, dass sie viel seltener zum Coiffeur gehen werden. Oder: Wer den Sale nicht nutzt, hat Geld verloren. Unter dem Hashtag #GirlMath, also Mädchenmathematik, gehen diese Videos gerade viral.
Einige Finanzexpertinnen und -experten halten den Trend allerdings für gefährlich. So erklärte etwa der Psychologe Brad Klontz gegenüber dem US-amerikanischen TV-Sender CNBC: «#GirlMath ist nur die jüngste Variante, mit der wir versuchen, finanzielle Verhaltensweisen zu rationalisieren, von denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollten.» Stellt sich also die Frage: Was, wenn wir immer mehr kaufen?
Tatsächlich ist Kaufsucht verbreiteter als man denkt – eine Erhebung des Bundesamts für Gesundheit aus dem Jahr 2019 zeigt, dass es in der Schweiz rund 330’000 kaufsüchtige Erwachsene gibt – und ein Indiz, dass mit dem Kaufverhalten etwas nicht mehr so stimmt, ist eben auch die ständige Rechtfertigung vor sich selbst und anderen für Käufe. Natürlich kann man nicht direkt vom Hashtag auf eine pathologische Kaufsucht schliessen – doch wie schnell sich so ein Suchtverhalten aufbauen kann, erklären Kathrin Honegger und Tobias Müller in der dieser Episode. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 23.11.2023 SRF zwei Snooze-Taste: Ist das Schlummern am Morgen besser als sein Ruf?
Folge 47Viele Schlafexpertinnen und -experten sind sich einig: Snoozen hat negative Auswirkungen auf den Schlaf, die Stimmung sowie kognitive Prozesse. Denn durch das Betätigen der Schlummertaste soll der zirkadiane Rhythmus – der Rhythmus des Körpers, der etwa Organe steuert – durcheinandergebracht werden.
Unnötig verkürzter Schlaf
Das könnte, laut Schlafforschenden, dazu führen, dass das Gehirn nicht mehr weiss, ob es das System nun aufwecken oder wieder müde machen soll, was zu einer anhaltenden Abgeschlagenheit führen kann. Ausserdem wird der Schlaf unnötig verkürzt, wenn am Abend vorher der Wecker extra eine halbe Stunde früher gestellt wird, um genügend Zeit zum Snoozen zu haben.
Stress-Booster Snoozen?
Wissenschaftlich ist das Ganze allerdings nie wirklich seriös untersucht worden – bis jetzt. Das hat nun ein Forschungsteam um die Psychologin Tina Sundelin von der Universität Stockholm nachgeholt, indem sie eine Runde von Studienteilnehmenden ins Schlaflabor einchecken liessen. An einem Morgen durften sie 30 Minuten lang nach dem Klingeln des Weckers weiter dösen, am anderen mussten sie sofort aufstehen.
Positive Auswirkungen in Studie
Das Ergebnis: Es gab keine eindeutigen Schlummer-Auswirkungen auf den Cortisolspiegel , die morgendliche Schläfrigkeit, die Stimmung oder die nächtliche Schlafstruktur, wie die Forschenden im Fachblatt «Journal of Sleep Research» berichten. Tatsächlich hatte das Snoozen sogar positive Auswirkungen auf manche Teilnehmenden. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 07.12.2023 SRF zwei Microdosing: Wie harmlos ist der tägliche Mini-Trip wirklich?
Folge 48Immer mehr Menschen nutzen Kleinstdosen von psychedelischen Substanzen wie LSD oder Psilocybin als Hirndoping, als Selbsttherapie bei depressiven Verstimmungen oder zur Entspannung – LSD-Microdosing: das Wundermittel?
In der Schweiz ist Microdosing verboten. Doch ein theoretischer Ausflug in die LSD-Welt lohnt sich trotzdem: Entdeckt wurde es 1943 vom Basler Chemiker Albert Hofmann, in der Hippie-Ära erlebte es einen Boom. Die «Normal-Dosis» sorgt für traumähnliche Halluzinationen, weil es dem körpereigenen Neurotransmitter Serotonin ähnelt – ein Botenstoff, über den Nervenzellen Signale austauschen. Deswegen bewirkt die Einnahme, dass Hirnregionen miteinander kommunizieren, die normalerweise wenig miteinander zu tun haben.
Beim Microdosing erlebt man keinen Rausch. Die Wirkung ist subtil – im Gegensatz zur normalen Tripdosis von LSD, bei der bis zu 100 Mikrogramm konsumiert werden, sind es beim Microdosing gerade Mal ein Zehntel davon.
Aber was bringt es? Gibt es wirklich wissenschaftliche Beweise für die Wirkungsweise, die viele dem Microdosing nachsagen? Und: Gibt es Nebenwirkungen? Kathrin Hönegger und Tobias Müller haben Studien durchforstet und Experten befragt. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 21.12.2023 SRF zwei Health-Killer Sitzen: Kann man stundenlanges Sitzen so einfach wettmachen?
Folge 49Einstein² Keyvisual 2022 SRFBild: SRF2In einer früheren Episode sprachen Kathrin Hönegger und Tobias Müller bereits über die 10’000-Schritte-Lüge: Viele sind davon überzeugt, dass man für ein langes Leben 10’000 Schritte machen muss. Stimmt aber gar nicht. Was aber stimmt: Dass Sitzen extrem schlecht für die Gesundheit ist.
Hier sind die eindrücklichen Fakten: Langes Sitzen ist ein Problem, weil es das Risiko für zahlreiche Krankheiten erhöht. Zum Beispiel Rückenschmerzen, Diabetes Typ-2, Adipositas, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Gefährliche an Bewegungsmangel ist, dass er den Stoffwechsel verändert. Auch das Gehirn leidet unter langem Sitzen: Der Hippocampus, eine Gehirnregion, die für Lernen und Erinnern verantwortlich ist, wird durch langes Sitzen schlechter vernetzt.
Langes Sitzen kann die Lebenserwartung sogar insgesamt verkürzen. Oder andersrum gesagt, hat eine bereits im Jahr 2012 veröffentlichte Studie ergeben, dass weniger als drei Stunden am Tag Sitzen, die Lebenserwartung im Durchschnitt um bis zu zwei Jahre erhöht.
Jetzt kommt aber eine gute Neuigkeit um die Ecke gebogen: Ein flotter Spaziergang von nur 22 Minuten pro Tag soll angeblich ausreichen, um die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von zu viel Sitzen auszugleichen, so eine Studie, die Ende Oktober im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht wurde. Anscheinend kann mässige bis kräftige körperliche Betätigung dieses erhöhte Risiko der sitzenden Lebensweise jedoch beseitigen. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 04.01.2024 SRF zwei Deshalb kommen manche Menschen immer zu spät
Folge 50Einstein² Keyvisual 2022 SRFBild: SRF2Wladimir Putin kommt ständig zu spät. Bei einem Treffen im Jahr 2014 hat er die deutsche Kanzlerin Angela Merkel vier Stunden und 15 Minuten warten lassen. Es muss nicht immer so extrem sein – aber sicher kennt jeder einen Menschen, der oder die es mit der Pünktlichkeit nicht ganz so eng nimmt. Oder es einfach nicht auf die Reihe bekommt, zur vereinbarten Zeit zu erscheinen.
Nur: Woran liegt das? Laut Psychologinnen und Psychologen liegt das an der Persönlichkeitsstruktur: In Sachen innerer Taktung soll es zwei Typen geben: zeitorientierte und erlebnisorientierte. Die zeitorientierten Menschen sind strukturiert, haben die Uhr stets im Blick und planen realistisch. Erlebnisorientierte Menschen vergessen schnell die Zeit um sie herum, sind präsenter im Moment und unterschätzen den Zeitaufwand für Aufgaben eher.
Auch die Psychologin Isabell Winkler von der TU Chemnitz untersucht, wie sich Menschen beim Warten fühlen und wovon abhängt, wie pünktlich sie zu einem Termin kommen. Die Antworten darauf, liefern Kathrin Hönegger und Tobias Müller in dieser Episode – und auch Tipps zum Umgang mit der Unpünktlichkeit gibt es.
Übrigens: Bis zu drei Minuten Verspätung ist für Schweizerinnen und Schweizer laut Umfragen okay. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 18.01.2024 SRF zwei Migräne: Wie das Hämmern womöglich entsteht – und was helfen kann
Folge 51Einstein² Migräne: Wie das Hämmern womöglich entsteht – Und was helfen kann Moderatorin Kathrin Hönegger Copyright: SRFBild: SRFIn der Schweiz leidet rund eine Million der Bevölkerung an Migräne. Jeder fünfte Schweizer kennt die hämmernden, pulsierenden Schmerzen aus eigener Erfahrung – oder kennt sie zumindest aus Erzählungen aus dem Umfeld. Migräne wird charakterisiert durch dumpfe, drückende und pochende Kopfschmerzattacken, die mehrere Stunden oder Tage anhalten können.
Mithilfe spezieller bildgebender Verfahren (Positronenemissions-Tomografie) konnte nachgewiesen werden, dass im Gehirn ein Bereich – das sogenannte Migräne-Zentrum im Hirnstamm – aktiviert und verstärkt durchblutet wird. Dieses «Migräne-Zentrum» reagiert überempfindlich auf Reize. Man geht heute daher davon aus, dass eine Migräneattacke mit einer Überaktivität von Nervenzellen im Hirnstamm beginnt . Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Licht-, Geräusch- und Geruchsüberempfindlichkeit gehören auch dazu.
Migräne mit Aura:
Die Migräne mit Aura tritt seltener auf, wird allerdings von der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft als «die klassische Migräne» bezeichnet. In diesem Fall kommt es unmittelbar vor Beginn der Migräne (bis zu 60 Minuten vorher) zu neurologischen Symptomen wie Sehschwäche, Lichtblitzen, Schwindel oder Sprachstörungen.
Migräne ohne Aura:
Die verbreitetste Form der Migräne ist allerdings die ohne Aura. Der Kopfschmerz nimmt meist halbseitig langsam zu, ohne sich durch neurologische Ausfallserscheinungen anzukündigen.
Grundsätzlich kann Migräne in jedem Alter auftreten, allerdings kommt sie am häufigsten zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr vor. Und: Frauen sind bis zu dreimal häufiger betroffen als Männer. Bisher kann man Migräne nicht heilen, sondern nur die Symptome lindern. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 08.02.2024 SRF zwei Warum unser Gehirn von Unsicherheit profitiert
Folge 52Einstein² Warum unser Gehirn von Unsicherheit profitiert Tobias Müller denkt nach. Copyright: SRFBild: SRFSicherheit ist Menschen wichtig. Manchen wichtiger als anderen – aber grundsätzlich liebt es das Gehirn, wenn alles planbar und vorhersehbar ist. Aber in Zeiten von Krieg und Klimakrise, rückt das Sicherheitsbedürfnis oft in den Fokus. Deshalb hat das deutsche Zukunftsinstitut das Thema Sicherheit 2023 auch als Megatrend beschrieben – allerdings als paradoxen.
Paradox deshalb, weil zwar das Empfinden fu¨r Risiken und Gefahren zunimmt, wir aber – wenn man sich Statistiken anschaut – in Europa in der sichersten aller Zeiten leben. Genau diese Sicherheit, sagen Expertinnen und Experten, fu¨hrt allerdings dazu, dass wir Unsicherheitsgefu¨hle intensiver wahrnehmen.
Dabei zeigt die Neurowissenschaft: Es kann auch gut sein, nicht alles zu wissen. Der Neurowissenschaftler Joseph Kable von der Uni in Pennsylvania etwa, sagt: «Ungewissheit macht einen empfänglicher für neue Informationen». Und zwar, weil sie eine Rolle bei der Vorbereitung des Gehirns auf das Lernen spielt.
Wie genau sich diese Unsicherheit auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt? In dieser Episode gibt es die Auflösung. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 22.02.2024 SRF zwei Das Geheimnis der perfekten Entschuldigung
Folge 53Einstein² Keyvisual 2022 SRFBild: SRF2Bereits 2017 haben Forschende aus Ohio sie ausfindig gemacht: sechs Komponenten, die eine Entschuldigung haben muss, damit einem verziehen wird. Sich zu entschuldigen, sei laut Forschenden nämlich nur die erste der sechs Komponenten. Die zweite ist, zu erklären, was genau aus der eigenen Sicht schiefgelaufen ist. Die dritte, sich dafür uneingeschränkt verantwortlich zu erklären. Welche drei Komponenten noch für eine gute Entschuldigung verantwortlich sind, erklären Kathrin Honegger und Tobias Müller in dieser Episode. Doch das ist nicht alles.
Eine neue Studie zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Versöhnung höher ist, wenn man sich so entschuldigt, wie es das andere Geschlecht machen würde – als Frau also eine männliche Sprache für die Entschuldigung verwendet, als Mann eine weibliche.
Das Forschungsteam bezeichnete Entschuldigungen mit eher männlicher Sprache als «agierend» und solche mit eher weiblicher Sprache als «gemeinschaftlich». Und: Sie haben herausgefunden, dass Frauen, die sich im männlichen Stil entschuldigten, davon profitierten, weil sie ein höheres Mass an Durchsetzungsvermögen an den Tag legten und ihre wahrgenommene Kompetenz steigerten, schreibt eine Forscherin im Fachmagazin «Journal of Applied Psychology». Die Männer, die sich mit einer Entschuldigung eher sanft und gemeinschaftlich verhielten, kamen auch besser weg. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 07.03.2024 SRF zwei Reichen drei Minuten Training, um diese Muskeln zu bekommen?
Folge 54Einstein² Reichen drei Minuten Training, um diese Muskeln zu bekommen? Kathrin Hönegger: Welche Sportart hilft am effizientesten, Muskeln aufzubauen? Copyright: SRFBild: SRFAurum oder EMS: Was bringt wirklich effizient und schnell Trainingserfolge? Tobias und Kathrin haben’s selbst ausprobiert. In dieser Episode teilen die beiden ihre Erfahrungen.
Aber was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Aurum kombiniert die High Intensity Trainings Methode und isokinetische Trainingsgeräte, um Trainierende an die Belastungsgrenze zu bringen – und das innerhalb von sechs Minuten pro Woche. So sollen Muskeln, Knochen, Lungen, Herz und das zentrale Nervensystem gestärkt werden.
EMS ist eigentlich Training mit Strom. Das Versprechen: 20 Minuten Training mit Elektromyostimulation reichen aus.
Die Idee: Bei EMS gelangt der Strom von den Elektroden einer Ganzkörperweste über angefeuchtete Pads auf der Haut direkt zu den Nervenenden. Die Stromimpulse, kontrahieren den Muskel oder verstärken die willentliche Kontraktion des Sportlers oder der Sportlerin.
Heisst also: Die Teilnehmenden müssen keine Gewichte stemmen, sondern nehmen verschiedene vorgegebene Haltungen ein, die eine gewisse Muskelspannung erzeugen. Durch zusätzlichen Strom werden die Muskeln stärker beansprucht – ganz ohne Hanteln.
Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zum herkömmlichen Krafttraining trainiert man so alle grossen Muskelgruppen gleichzeitig. Deshalb dauert das Training auch nur 20 Minuten. Nur die Unterarme und Wadenmuskeln werden nicht zusätzlich verstärkt.
Welche Methode zum Erfolg geführt hat – und warum einer der beiden Moderatoren während des Muskel-Experiments sogar Muskeln verloren hat, gibt es in dieser Episode zu sehen. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 21.03.2024 SRF zwei Gesunder Menschenverstand: Was ist damit gemeint?
Folge 55Einstein² Was ist damit gemeint? Was ist eigentlich der vielbeschworene gesunde Menschenverstand? SRFBild: SRF2Original-TV-Premiere Do 04.04.2024 SRF zwei Therapy Speak: Was passiert, wenn Tiktok-Influencer Therapeuten spielen
Folge 56Einstein² Therapy Speak: Was passiert, wenn TikTok-Influencer Therapeuten spielen Tobias Müller und Kathrin Hönegger Copyright: SRFBild: SRFDer Begriff Therapy «Speak» meint, dass Menschen Begriffe aus dem psychologischen Jargon benutzen, ohne die wirkliche Bedeutung dahinter zu kennen.
Laut Psychologinnen und Psychologen, die auch auf Tiktok sind, besonders oft falsch verwendet: Wörter wie «toxisch», «Trigger» oder «Narzissmus».
Das Problem liegt auf der Hand: Je öfter solche Begriffe falsch eingesetzt werden, desto grösser wird das gefährliche Halbwissen um sie herum. Dazu kommt: Auf Tiktok oder Instagram geben Menschen ohne psychologische Ausbildung Auskünfte über die psychische Verfassung von bestimmten Personen, mutmassen über narzisstische Störungen ihrer Ex-Freunde oder geben an, sich «trauma-informed» zu verhalten, ohne wirklich zu wissen, was das ist.
Die Einstein^2-Redaktion hat mit der Kölner Jugend- und Medienpsychologin Maren Urner über dieses Problem gesprochen. Sie sieht in den Videos gewisse Risiken: «Wissenschaftliche Begriffe werden auf Social Media oft verkürzt und vereinfacht wiedergegeben. Es ist zwar nicht der Anspruch von Tiktok & Co., eine wissenschaftliche Plattform zu sein. Aber Krankheitsbilder wie Narzissmus oder ADHS benötigen in jedem Fall die Diagnose einer Fachperson.» Das sagt im Übrigen auch Pro Juventute. Es sollte weder übersensibilisiert noch überdiagnostiziert werden.
Das Wissen über psychische Probleme kann tatsächlich dazu beitragen, dass Menschen ihre mentale Gesundheit schlechter einschätzen, wie eine Studie aus Australien zeigt. Nach Kampagnen, die besonders intensiv über psychische Krankheiten informierten, wurden 3000 Probandinnen und Probanden befragt. Das Resultat: Diejenigen, die weniger über psychische Gesundheit wussten, wurden auch seltener als depressiv eingestuft. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 18.04.2024 SRF zwei Mind after Midnight: Funktioniert das Gehirn nachts anders?
Folge 57Einstein² Mind after Midnight: Funktioniert das Gehirn nachts anders? Kathrin Hönegger und Tobias Müller Copyright: SRFBild: SRFNachts wirkt die Welt irgendwie anders. Aber auch die Menschen? Tatsächlich büssen gesunde Menschen spät in der Nacht an kognitiver Leistungsfähigkeit ein. Sie treffen in unerwarteten Situationen schlechtere Entscheidungen, gehen eher Risiken ein, sind impulsiver und können sich schwer konzentrieren. Sie verhalten sich, als wären sie betrunken. Nach 17 Stunden ohne Schlaf – also nachts um eins, wenn man seit acht Uhr morgens wach ist – schnitten Freiwillige in psychomotorischen Tests so ab, als hätten sie 0,5 Promille Alkohol im Blut.
Das liege nicht nur am Schlafmangel, sagen Forschende. Es müssen subtilere Effekte im Kortex sein, also das Areal, das beim Planen und Entscheiden aktiv ist und besonders viel Energie verbraucht. Der präfrontale Kortex wechselt nach Mitternacht in den Energiesparmodus, während andere Hirnareale in Betrieb bleiben, vermuten Forschende.
Von Andrew Tubbs von der University of Arizona stammt die «Mind after Midnight»-Hypothese: Demnach ermüdet der Verstand in den frühen Morgenstunden wie ein Muskel, der den Tag über viel geleistet hat. Die Synapsen, die den ganzen Tag über Nervenimpulse durch den Kortex schicken, müssen sich neu kalibrieren.
Ausserdem verändert sich der Dopaminspiegel im Gehirn und hemmt die Aktivität des präfrontalen Kortex weiter. Die Kontrollmechanismen funktionieren nicht mehr so gut. Die Amygdala dreht auf, jenes Gehirnareal, das Angst und Emotionen steuert. Wir verhalten uns impulsiver, sind risikobereiter, emotional labiler, hängen in Grübelschleifen fest und machen Fehler. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 02.05.2024 SRF zwei Was bringt die Blutzuckerspiegel-Diät wirklich?
Folge 58Einstein² Was bringt die Blutzuckerspiegel-Diät wirklich? Kathrin Hönegger und Tobias Müller mit Sandwich SRFBild: SF23,4 Millionen Follower hat «Glucose Goddess» auf Instagram. Die «Glukosegöttin» Jessie Inchauspé hat mit ihrem Buch «Der Glukose-Trick» einen Bestseller gelandet, der in über vierzig Sprachen übersetzt wurde.
Gleichzeitig hat die junge Biochemikerin einen Gesundheitstrend geschaffen: Glukose messen und Blutzuckerspitzen vermeiden. Denn gemäss der Autorin sollen Fettpölsterchen, Hautprobleme oder Stimmungsschwankungen direkt mit ernährungsbedingten Schwankungen des Blutzuckerspiegels zusammenhängen.
So messen mittlerweile Millionen von Menschen ihre Blutzuckerwerte mit einem Sensor und probieren die Tricks aus, die Jessie Inchauspé auf ihren Kanälen empfiehlt. Aber helfen diese Strategien tatsächlich dabei, die Achterbahnfahrten des Blutzuckerspiegels zu vermeiden – und eine bessere Haut und mehr Energie zu bekommen? Kathrin Hönegger und Tobias Müller sind dem Ganzen in einem Selbst-Experiment auf die Spur gegangen – und ordnen mithilfe einer Expertin ein. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 16.05.2024 SRF zwei Tschüss, ciao, adios: Was Abschied mit uns macht – und warum
Folge 59Einstein² Tschüss, ciao, adios: Was Abschied mit uns macht – und warum Kathrin Hönegger und Tobias Müller sind traurig.Bild: SRFTschüss, Ciao, Adios: Die meisten verbinden Abschiede mit etwas Traurigem. Das lässt sich physisch auch ziemlich einfach erklären: Bei einer Trennung werden Menschen plötzlich die Neurotransmitter entzogen, an die sie sich gewöhnt haben. Der ständige Strom von Wohlfühlhormonen wie Dopamin und Oxytocin bleibt aus. Gleichzeitig gibt es einen Anstieg von Stresshormonen wie Cortisol und Noradrenalin.
Tatsächlich gibt es laut Psychologinnen unterschiedliche Abschieds-Typen: Die «Vermeider» binden sich erst gar nicht oder geben bald auf und die «Ängstlich-Ambivalenten» klammern und harren zu lange in verfahrenen Situationen aus.
Doch es gibt Menschen, die sich leichter damit tun, etwas zurückzulassen. Ein Talent zum Abschied liegt ihnen bereits in den Genen. Psychologen gehen davon aus, dass es für jeden Menschen ein optimales Erregungsniveau gibt, das zu etwa 70 Prozent die Gene bestimmen. Nur jeder Fünfte hält sein Erregungsniveau gerne hoch, indem er häufig neue Reize sucht: Diese Sensationssuchenden lassen sich von Neugierde und Aufbruchslust zu immer neuen Orten und Menschen treiben, sie suchen das Abenteuer in riskanten Sportarten und sind schnell gelangweilt. (Text: SRF)Original-TV-Premiere Do 30.05.2024 SRF zwei
zurück
Erinnerungs-Service per
E-Mail