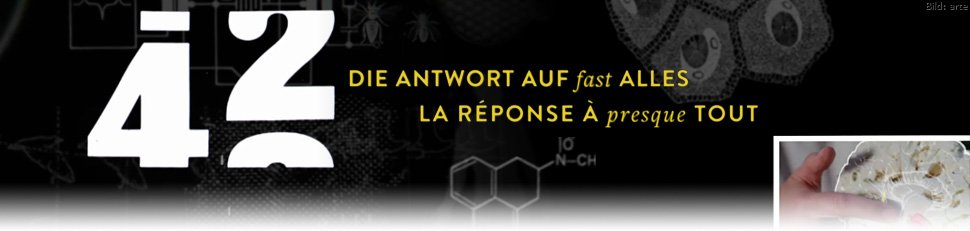2021/2022, Folge 22–42
Werden wir nicht mehr fliegen?
Folge 22 (26 Min.)Auch für die Energiewende beim Fliegen gilt: weg vom Verbrenner und fossilen Kraftstoffen, hin zu Antrieben mit erneuerbaren Energien. Professor Johannes Hartmann und sein Team vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt wollen bis zum Jahr 2035 Flugzeuge entwickeln, die klimaneutral betrieben werden können. Elektroflugzeuge sind zwar schon erfolgreich im Einsatz, aber mit den Batterien, die sie transportieren können, erzielen sie nur geringe Reichweiten. Ab 500 Kilometer Reichweite werden die Batterien zu groß und zu schwer.
Für längere Strecken will man auf die Wasserstofftechnologie setzen. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie man die voluminösen Wasserstofftanks unterbringen soll, sondern es gibt noch eine weitere Herausforderung: Da Flugzeuge sehr langlebige Güter sind und die aktuellen Flugzeugflotten noch lange im Einsatz sein werden, braucht es nachhaltige Treibstoffe. Wirklich nachhaltig sind jedoch nur Treibstoffe, die ohne organische Stoffe aus der Land- oder Forstwirtschaft auskommen und mit erneuerbaren Energien hergestellt werden.
Nicht nur bei Flugzeugen und Treibstoffen lässt sich Fliegen klimafreundlicher gestalten. Auch andere Flugrouten können viel ausrichten – wenn sie etwa Regionen meiden, in denen klimaschädlichen Kondensstreifen entstehen können. „Kondensstreifen-Hotspots bilden sich normal in neun bis zwölf Kilometer Höhe in der Atmosphäre“, sagt Prof. Christiane Voigt vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre. „Man muss nur kurz drunter fliegen, vielleicht in acht Kilometer Höhe, und auch nur gezielt dann, wenn sie da sind, um sie zu vermeiden.“ (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 12.02.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 13.01.2022 arte.tv Werden wir Roboter lieben?
Folge 23 (26 Min.)Schätzungen zu Folge gibt es weltweit inzwischen mehr als 1,7 Millionen Roboter mit sozialen Eigenschaften. Sie pflegen, bilden, helfen und unterhalten uns. Längst gibt es auch hoch technisierte Sexroboter. Doch können diese Maschinen tatsächlich Gefühle entwickeln – oder gar Liebe empfinden? „Wir haben für unseren Roboter digitale künstliche Hormone entwickelt. Und wir simulieren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Veränderungen des Hormonhaushalts bei einem Menschen, der sich verliebt“, sagt Hooman Samani, Roboterentwickler an der Universität Plymouth.
Und auch umgekehrt kommen wir der Mensch-Maschine-Beziehung näher: Für den Kognitionspsychologen Martin Fischer von der Universität Potsdam sprechen gewisse psychologische Effekte dafür, dass unsere Einstellung gegenüber Robotern in Zukunft immer positiver wird, allein deshalb, weil wir im Alltag immer mehr mit ihnen zu tun bekommen werden. Werden wir mit Robotern die Nähe eines echten Menschen oder Tieres ersetzen? Der Informations- und Maschinenethiker Oliver Bendel von der Fachhochschule Nordwestschweiz hält das sogar für wahrscheinlich: „Viele werden Beziehungen mit einer dritten Kategorie von Existenzen eingehen.
Manchen wird es auch eine Weile helfen. Es ist einfach die Frage, ob es ihnen dauerhaft hilft.“ Und noch eine wichtige Frage stellt sich: Schon heute weiß man aus Japan, dass der alltägliche Kontakt zu Robotern uns Menschen gravierend verändern kann. Was, wenn die Roboter in Zukunft nicht immer menschlicher werden – sondern wir immer mehr zu Robotern? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 19.02.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 20.01.2022 arte.tv Wozu brauchen wir Parasiten?
Folge 24 (27 Min.)Die Angst vor Parasiten hat durchaus ihre Berechtigung, denn Parasiten können dem Menschen und auch den Tieren erheblichen Schaden zufügen. Deshalb schützen wir uns vor Infektionen, die von Würmern, Zecken, Stechmücken und anderen Parasiten übertragen werden. Vor lauter Abscheu wird aber häufig übersehen, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten Parasiten haben: Sie sind wahre Meister der Manipulation. Sie schaffen es, unbemerkt in ihre Wirte einzudringen, sie zu kontrollieren und fernzusteuern. Hinter diesem scheinbar heimtückischen Verhalten steckt ein besonderes Lebensprinzip, das sich im Laufe der Evolution enorm bewährt hat.
Die Evolutionsbiologin Susanne Foitzik von der Universität Mainz ist davon überzeugt, dass Parasiten die Evolution aller Arten vorantreiben, indem sie ihre Wirte zwingen, immer wieder neue Resistenzen zu entwickeln. Davon profitiert auch der Mensch. Der Zellbiologe und Parasitologe Markus Engstler von der Universität Würzburg sieht das genauso. Er betont aber, wie wichtig es ist, die Ausbreitung schädlicher Parasitenarten wie zum Beispiel der Tsetsefliege einzudämmen.
Die US-amerikanische Meeresbiologin Dana Morton erforscht die Artenvielfalt in marinen Algenwäldern und hat herausgefunden, dass Parasiten auch in den Ökosystemen eine Schlüsselrolle spielen. Laut dem Parasitologen Richard Lucius von der Humboldt-Universität Berlin könnten der Klimawandel und das globale Artensterben den Parasiten jedoch schon bald zum Verhängnis werden. Dies würde wiederum das natürliche Gleichgewicht gefährlich ins Wanken bringen. Lohnt es sich also doch, die ewig bekämpften Parasiten zu retten? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 26.02.2022 arte Deutsche Online-Premiere Mi 23.02.2022 arte.tv Können wir länger wach bleiben?
Folge 25 (25 Min.)Wer hat sich noch nie gewünscht, der Tag hätte 48 Stunden? Entweder weil wir so richtig Spaß hatten oder die zusätzliche Zeit für Prüfungen oder eine wichtige Arbeit gebraucht hätten. Die Länge eines Tages können wir nicht verändern. Aber wir könnten doch ganz einfach weniger schlafen und damit wertvolle Stunden gewinnen. Oder nicht? So ganz einfach scheint das nicht zu sein. Denn ausreichend Schlaf ist wichtig. Sogar lebenswichtig. Warum, damit beschäftigt sich die Wissenschaft erst seit etwa 70 Jahren. Davor hielten Forschende den Schlaf für nicht weiter beachtenswert. Mittlerweile wissen wir: Da geschieht eine Menge und noch haben wir nur einen Bruchteil dessen verstanden, was während des Schlafs in unserem Körper vor sich geht.
Wer wenig schläft, lernt völlig neue Seiten an sich kennen, so wie beispielsweise der Extremsportler Stefan Schlegel. Er schläft während des längsten Non-Stop-Radrennens der Welt, des Race Across America, zehn Tage lang nur etwa zwei Stunden über den Tag verteilt – und leidet am Ende unter Halluzinationen. Ist das der Preis, den wir zahlen, wenn wir länger wach sein wollen? Oder könnten wir unseren Schlaf durch Medikamente oder eine andere Verteilung unserer Schlummerstunden über den Tag hinweg reduzieren und dabei gesund und munter bleiben? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 05.03.2022 arte Deutsche Online-Premiere Fr 04.02.2022 arte.tv Sind Kryptowährungen das bessere Geld?
Folge 26 (28 Min.)Mit Kryptowährungen sind in den letzten Jahren viele Menschen extrem reich geworden. Auch wenn der Bitcoin-Kurs kurzfristig starken Schwankungen unterliegt, geht der langfristige Trend steil nach oben. Viele Menschen vertrauen auf die digitalen Währungen und einige glauben sogar, dass sie grundlegende Probleme unseres Finanzsystems lösen können. Was steckt dahinter? Und warum halten Ökonomen das für Humbug? Mit El Salvador hat im September 2021 das erste Land weltweit den Bitcoin als legales Zahlungsmittel eingeführt. Alle Unternehmen sollen ab sofort neben dem US-Dollar auch die Kryptowährung von ihren Kunden akzeptieren. „Eine Schnapsidee“, sagt der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger.
Der Kurs des Bitcoins sei viel zu wechselhaft, das Vertrauen in Kryptowährungen eine gefährliche Wette, die am Ende kaum aufgehen könne. Wirtschaftswissenschaftler Philipp Sandner beschäftigt sich mit der Blockchain-Technologie, die für ihren immensen Energieverbrauch extrem in der Kritik steht. Er erklärt, der Energieverbrauch sei für den Bitcoin notwendig, da er sich damit gegen Angriffe von außen schütze. Kryptowährungen sind für viele Menschen schwer zu verstehen. Doch egal, was man von Bitcoin und Konsorten halten mag: Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, lernt auch eine Menge über unser bisheriges Geldsystem. Und das kann sich lohnen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 12.03.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 03.03.2022 arte.tv Leben wir in einem Schwarzen Loch?
Folge 27 (27 Min.)Woher kommt die Materie, aus der wir Menschen und mit uns der Rest des Universums geformt ist? Die Astronomen und die Astrophysiker haben dazu Theorien – keine ist allerdings so ungewöhnlich wie die des Mathematikers und Physikers Nikodem Poplawski: Er ist der Überzeugung, dass Schwarze Löcher neue Universen gebären – und dass wir möglicherweise in einem Schwarzen Loch eines größeren Universums existieren. Kann das sein? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Silke Britzen, Nadine Neumayer und Jan Steinhoff sind da skeptisch – stellen sich aber auch die Frage, ob der Urknall wirklich der Anfang unseres Universums war.
Was jedenfalls im Inneren eines Schwarzen Lochs vorgeht, entzieht sich unserer Kenntnis. Wichtig ist dabei der Mittelpunkt, die sogenannte Singularität, der absolute Nullpunkt. Sie komprimiert die ins Schwarze Loch gefallene Materie auf ein Allerkleinstes und löscht dabei jedwede Information. So weit zumindest die Voraussagen von Albert Einstein von vor über 100 Jahren.
Die Existenz einer Singularität ist allerdings nur eine viel diskutierte Theorie, die noch lange nicht bewiesen ist. Wenn es keine Singularität gibt, wie Poplawski glaubt, würde aus einem Schwarzen Loch ein Baby-Universum hervorgehen können, das sich zu einem immer größer werdenden Universum aufbläht. Klingt wie Sci-Fi? Willkommen zu einem Gedankenexperiment, das bewusstseinserweiternde Wirkungen entfaltet und möglicherweise darauf hindeutet, dass wir die Urknalltheorie über den Haufen werfen müssen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 19.03.2022 arte Deutsche Online-Premiere Mo 07.03.2022 arte.tv Sollten wir mehr träumen?
Folge 28 (26 Min.)Auch wenn wir uns oft nicht erinnern können: In jeder durchschlafenen Nacht produzieren wir in unserem Kopf etwa zwei Stunden Traumerleben in Bildern. Ein scheinbar unkontrollierbarer Kinofilm. Und kreativer als unsere Wirklichkeit. Leider vergessen wir das meiste, was wir träumen. Es gibt jedoch Mittel und Wege, das Erinnern an Träume zu trainieren, verrät der Schlaf- und Traumforscher Michael Schredl, der selbst in bald 40 Jahren rund 15.800 Träume aufgeschrieben hat. Am kreativsten könnten wir Träume für uns nutzen, wenn wir klarträumen. „Ein Klartraum ist ein Traum, in dem Sie wissen, dass Sie träumen“, sagt Ursula Voss von der Goethe-Universität Frankfurt.
„Das heißt, Sie können sich selbst von außen betrachten. Und teilweise können Sie Kontrolle über den Traum ausüben.“ Damit lassen sich bestimmte Fähigkeiten trainieren. „Wenn ich einen Sport üben möchte, dann kann ich im Klartraum Bewegungsabläufe trainieren“, schildert die Kognitionsforscherin Katharina Lüth aus ihren eigenen Klarträumen. Da das Klarträumen aber viel Training braucht, hat Adam Haar Horowitz am MIT eine Technologie entwickelt, mit der auch Nichtklarträumer ihre Träume besser für sich nutzen können.
Das elektronische Armband „Dormio“ soll helfen, den besonderen Zustand der Hypnagogie zu erreichen. „Das ist ein ähnlicher Geisteszustand, wie man ihn in Momenten extremer Kreativität oder kognitiver Flexibilität erlebt. Viele Menschen nutzen diesen Zustand, die Hypnagogie, für kreatives Brainstorming“, sagt Adam Haar-Horowitz. Träume führen in eine Welt voller Fantasie, die der Vernunft entzogen ist. Sollten wir mehr träumen? Ja, unbedingt, denn Träume können unser Wachleben kreativer machen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 26.03.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 10.03.2022 arte.tv Wohin wandert der Mensch?
Folge 29 (27 Min.)BewegungsströmeBild: SRF/NDR/ARTELange Zeit waren wir Nomaden. Heute verlassen die wenigsten Menschen das Land, in dem sie geboren wurden, doch es werden mehr. Forschende versuchen, ein System dahinter zu erkennen. Können sie Aus- und Einwanderungsbewegungen vorhersagen? Von wo nach wo sich Menschen auf der Erde bewegen, ändert sich ständig. Manche gehen ins Nachbarland, andere reisen um die halbe Welt. Einwanderung kann politische Systeme erschüttern, gleichzeitig ist sie ein Wirtschaftsfaktor. Wer profitiert von Migration? Es gibt eine Menge Mythen rund um diese Wanderungsbewegungen.
Die Dokumentation betrachtet das Thema wissenschaftlich anhand von Forschungsergebnissen. Forschende suchen schon lange nach Antworten auf die Frage, nach welchen Gesetzmäßigkeiten Migration funktioniert. Lässt sich aus früheren Migrationsbewegungen eine Formel ableiten? Seit dem 19. Jahrhundert tüfteln sie an möglichen Modellen – und tun es noch heute. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die Migration fördern und wohl auch in Zukunft verstärken werden. Dazu zählt zum Beispiel die Entwicklung von Technologien, die Menschen von ihren Arbeitsplätzen verdrängen.
Aber auch demografische Veränderungen und Wirtschaftskrisen, die Menschen dazu zwingen, sich anderswo Arbeit zu suchen. Hinzu kommt der Klimawandel. Und die Vernetzung: Je besser Menschen weltweit miteinander verbunden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich auf den Weg machen, sagt Parag Khanna, Politikwissenschaftler aus Singapur: „Wir waren die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte Nomaden. Können wir akzeptieren, dass wir auf Grund eigens verursachter Probleme wie den Klimawandel nun wieder zu Nomaden werden müssen?“ (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 30.04.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 31.03.2022 arte.tv Die Sprache der Tiere
Folge 30 (26 Min.)Eine MeeresschildkröteBild: SRF/NDR/ARTEDer Mensch ergründet das All, entschlüsselt DNA und bestimmt den Meeresspiegel millimetergenau. Eines aber ist für ihn noch ein großes Rätsel: die Sprache der Tiere. Denn die hat mit der unseren nicht viel gemeinsam: Elefanten kommunizieren im Infraschall, Katzen nutzen Vokallaute, Wale Flossenschläge. Was würde sich ändern, wenn sich all das tatsächlich übersetzen ließe? Menschen benutzen im Durchschnitt 16.000 Worte am Tag. Klug zusammengesetzt, ergeben diese in den meisten Fällen Sinn und es entsteht das, worüber wir uns definieren: unsere Sprache.
Auch wenn wir Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen, haben wir die Möglichkeit, einander zu verstehen. Früher machte es das Wörterbuch möglich, heute die Übersetzungs-App. Was, wenn es so etwas für die Laute eines jeden Tieres geben würde? „Die vokale Kommunikation der Tiere ist ein Fenster in ihr Innerstes“, sagt Daniela Hedwig vom Cornell Lab of Ornithology im Bundesstaat New York. Dort analysiert sie Laute, die im afrikanischen Regenwald aufgenommen wurden.
Im schwedischen Lund forscht die Phonetikerin Susanne Schötz an der Sprache der Hauskatze. Dafür wurde sie jüngst mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet. Den erhält, wer mit seiner Forschung erst für Schmunzeln sorgt und dann zum Nachdenken anregt. Wie Daniela Hedwig und Susanne Schötz arbeiten Forschende weltweit daran, die Kommunikation von Tieren zu entschlüsseln. Gelingt es, könnten wir besser verstehen, in welcher Situation sich Tiere wohlfühlen und sie artgerechter halten und besser schützen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 07.05.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 07.04.2022 arte.tv Werden wir immer dümmer?
Folge 31 (28 Min.)Grafik: Aus einem Gehirnmodell steigen bunte Blasen auf.Bild: NDRDer in Neuseeland lebende Politologe James Flynn entdeckte im Jahr 1984, dass die gemessenen Intelligenzwerte in zahlreichen Ländern seit Beginn des 20. Jahrhunderts kontinuierlich stiegen. Der sogenannte Flynn-Effekt. Begründet wurde dieser Anstieg mit besserer Ernährung und medizinischer Versorgung, aber vor allem breiterem Zugang zu Bildung. Kurz nach der Jahrtausendwende allerdings entdeckten norwegische Statistiker, dass der Flynn-Effekt nicht mehr wirkt. Im Gegenteil: Einige Länder verzeichnen seitdem sogar leicht rückläufige IQ-Werte. Bis heute rätseln Forschende an der Frage: Warum werden wir wieder dümmer? Verschiedene Theorien kursieren. Die kontroverseste ist die „Dysgenik“, das Phänomen, dass Akademikerfamilien im Schnitt weniger Kinder in die Welt setzen als gering Gebildete.
Zudem zögen nach der Vermutung einiger Intelligenzforschender bildungsferne Migranten den IQ-Schnitt der westlichen Industrieländer herunter. Viele Neurobiologen und -psychologen vermuten allerdings eher, dass die Digitalisierung und der Wandel der Medienlandschaft die IQ-Werte negativ beeinflussen könnten. Steigende Bildschirmzeiten und ständige Erreichbarkeit durch Smartphones verringerten nachweislich unser Konzentrationsvermögen. Unsere Hirne seien schlicht überfordert. Und auch äußere biologische Faktoren könnten ebenso einen Einfluss auf die Intelligenz haben, wie der exponentielle Anstieg der fossilen Brennstoffproduktion und die Alltagsnutzung von Plastik. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 14.05.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 14.04.2022 arte.tv Haben Computer Vorurteile?
Folge 32 (27 Min.)Künstliche Intelligenz ist längst unter uns: Im Navi lässt sie uns Staus umfahren, in Dating-Apps die große Liebe finden, sie schlägt uns Produkte oder Filme vor. Aber zunehmend ist KI auch an schwierigeren Entscheidungen beteiligt: In China zum Beispiel kommt sie in Gerichtsprozessen zum Einsatz. Viele Unternehmen lassen Algorithmen Bewerbungen aussortieren. Und Sicherheitsbehörden weltweit benutzen künstliche Intelligenz, um Menschen in Echtzeit zu identifizieren. Unbestechlich und rein objektiv oder voreingenommen? Können wir uns eigentlich sicher sein, dass dabei alles korrekt abläuft, nach unseren moralischen Vorstellungen? Daran haben Forschende erhebliche Zweifel. Annika Buchholz vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme zum Beispiel sagt: „Die KI ist genauso rassistisch wie wir Menschen“.
Das liege an den Daten über Menschen, mit der die KI arbeitet. Die stammen aus der Offline-Welt. Die Diskriminierung, die es dort gibt, ist in die Daten, mit der die KI rechnet, eingeschrieben. Die mathematischen Möglichkeiten, solche Verzerrungen zu korrigieren, sind begrenzt. Und nicht nur die Daten können ein Problem sein. Katharina Zweig von der TU Kaiserslautern untersucht, inwiefern sich auch durch die Vorgaben der Entwickelnden Fehler einschleichen. Ihr Fazit: In vielen Fällen könne die Maschine gar nicht in unserem Sinne gerecht entscheiden. Erwarten wir zu viel von den Computern? Oder können wir ihnen moralisches Handeln beibringen? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 21.05.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 19.05.2022 arte.tv Wie werden alle satt?
Folge 33 (28 Min.)Die Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, ist hocheffizient. Sie ernährt so viele Menschen wie nie zuvor in der Geschichte. Doch diese Effizienz hat einen Haken. Sie füllt zwar unsere Supermärkte, bringt aber unsere Erde an ihre Grenzen: Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität nehmen an vielen Orten ab, die Belastungen für die Umwelt durch Düngemittel und Pestizide nehmen zu. Der massive Chemieeinsatz von auf unseren Feldern sei dabei vergleichbar mit der Einnahme von „Antibiotika-Tabletten“, sagt Agrarökonom Gerold Rahmann: „Doch irgendwann sind die Schäden so groß, dass sie nicht mehr reparierbar sind.“ Zudem schreite der Klimawandel mittlerweile so schnell voran, dass unsere Kulturpflanzen „gar nicht mehr hinterherkommen“, so Agrarbiologe Nicolaus von Wirén.
Wir sollten also einerseits der Landwirtschaft weltweit helfen, dem Klimawandel zuvorzukommen, andererseits gilt es, die Erträge deutlich zu steigern, ohne den Planeten zusätzlich zu belasten. Wie können wir das schaffen? Liegt in der umstrittenen „Grünen Gentechnik“ die Lösung? Oder sollten wir eher auf radikale Ökologisierung setzen, um unsere Böden zu retten? Ist es sogar möglich, Landwirtschaft ohne „Land“ zu betreiben – in riesigen vertikalen Farmen? Und welchen Beitrag liefert künstliche Intelligenz zur Antwort auf die Frage, wie alle satt werden können? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 28.05.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 28.04.2022 arte.tv Werden wir mehr Drogen nehmen?
Folge 34 (27 Min.)Drogen, Suchtmittel, Rauschgift – ist das nicht gefährlich? Klingt nach Bahnhofsviertel, dunklen Parks und verschwitzten Clubs. Aber was, wenn das nur die halbe Wahrheit über Drogen ist? In mehreren Studien weltweit passiert gerade etwas Bahnbrechendes: Menschen mit Depressionen und posttraumatischer Belastungsstörung bekommen Psilocybin und MDMA, auch als Ecstasy bekannt, therapeutisch verabreicht – und die bisherigen Ergebnisse geben Anlass zu großer Hoffnung. Die Zulassung als Medikament könnte nur noch eine Frage von wenigen Jahren sein. Wie diese Drogen den Süchtigen und Depressiven helfen? Einfach gesagt: Sie öffnen sie für neue Erfahrungen, indem sie die Verbindungen im Gehirn kapern – und lassen sie damit aus dem Teufelskreis der Traurigkeit und Sucht ausbrechen.
Der Weg zu diesen Erkenntnissen war steinig, die Klassifizierung als illegale und gefährliche Drogen hatte es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bisher extrem schwer gemacht, mit ihnen zu forschen. Bedeutet das jetzt, dass wir unser Verhältnis zu Drogen überdenken müssen? Alles gar nicht so schlimm? Heroin, Crack, Kokain, LSD und Pilze …? So einfach ist das natürlich nicht. Aber es lohnt sich zu schauen, wieso unser Verhältnis zu Drogen so kompliziert ist und welche Chancen in manchen von ihnen stecken. Zeit für neue Erfahrungen. Zeit, unser Verhältnis zu Drogen neu zu ordnen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 04.06.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 05.05.2022 arte.tv Sind wir fit für den Mars?
Folge 35 (27 Min.)Marssimulation in der Antarktis. Extreme Kälte von bis zu minus 80 Grad herrscht in der Antarktis, vergleichbare Temperaturen wie auf dem Mars.Bild: Carmen Possnig / Carmen PossnigWenn ihr Science-Fiction-Filme über das Leben auf dem Mars schaut, überlegt mal folgendes: Bisher waren etwa 600 Menschen im Weltall unterwegs und die meisten haben ähnliche Erfahrungen gemacht: mit 28.000 Kilometer pro Stunde in Richtung Sonnensystem fliegen. Ankunft in der Erdumlaufbahn nur acht Minuten später. Der Blick auf die Erde ist fantastisch. Doch Moment mal! In der Raumstation ISS läuft niemand aufrecht, so wie das bei „Star Trek“ und vielen anderen Science-Fiction-Geschichten alltägliche Praxis ist. In der Realität ist es anders: Sobald in der Erdumlaufbahn die Schwerelosigkeit einsetzt, schwebt alles, auch die Körpersäfte. Die meisten Astronautinnen und Astronauten leiden unter der Weltraumkrankheit – ähnlich der Seekrankheit.
Ihnen wird übel, die Augen spielen verrückt, das Gesicht schwillt an, die Beine werden länger und nach ein paar schlaflosen Nächten – den Tag-Nacht-Rhythmus im All gibt es nicht – bekommen viele Raumfahrerinnen und Raumfahrer zu allem Übel auch noch starke Rückenschmerzen. Weltraummedizinerinnen und -mediziner forschen was das Zeug hält. Doch wie viel und vor allem was müssen wir über unsere Körper noch wissen, wenn wir schon in zehn Jahren auf den Mars wollen? Die Reise dorthin dauert mindestens sechs Monate. Dort angekommen, gibt es keine Luft zum Atmen, keinen festen Boden unter den Füßen, dafür eine starke kosmische Strahlung. Ist der menschliche Körper überhaupt für ein Leben außerhalb der Erde gemacht? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 11.06.2022 arte Deutsche Online-Premiere Mo 23.05.2022 arte.tv Können wir ins Jenseits blicken?
Folge 36 (27 Min.)Der Arzt Duncan MacDougall versuchte bereits 1907, die Existenz einer unsterblichen Seele mit wissenschaftlichen Mitteln nachzuweisen.Bild: NDR/ARTE / Der Arzt Duncan MacDougall versuchte bereits 1907, die Existenz einer unsterblichen Seele mit wissenschaftlichen Mitteln nachzuweisen.Ein helles Licht am Ende eines Tunnels, ein Kurzfilm des eigenen Lebens und unbeschreibliche Glücksgefühle – so beschreibt der Hirnforscher Gerhard Roth seine Nahtoderfahrung. Damit ist er nicht allein: Solche Erlebnisse machen Tausende Menschen jedes Jahr. Was steckt also dahinter? Wissenschaftler beschäftigen sich intensiv damit, die Mechanismen einer solchen Erfahrung zu ergründen und herauszufinden, ob diese Menschen wirklich ins Jenseits geblickt haben. Während die meisten Betroffenen davon überzeugt sind, erklären Forscher die meisten Nahtoderfahrungen mit neurologischen Prozessen im Gehirn. Außerdem argumentieren sie, sind die meisten Menschen mit Nahtoderfahrung „nur“ klinisch tot – und damit medizinisch gesehen noch quicklebendig.
Mit modernen Verfahren können sie den Prozess des Sterbens immer genauer entschlüsseln und sagen, was dabei im Gehirn passiert. Doch eine Frage bleibt: Warum haben wir überhaupt solche Erlebnisse? Eine ganz neue Studie stellt erstmals eine mögliche Erklärung dafür vor: Demnach könnte die Evolution dafür sorgen, dass wir den Moment des Sterbens als möglichst angenehm erleben. Deshalb sei das Gehirn darauf programmiert, Opioide auszuschütten oder alte, längst vergessene Erinnerungen auszugraben, wenn es aufs Ende zugeht. Der Neurologe Jens Dreier von der Charité Berlin spricht deshalb von einem „Algorithmus Sterben“. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 18.06.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 19.05.2022 arte.tv Werden wir ewig leben?
Folge 37 (30 Min.)Für Alternsforscherin Andrea Maier ist es eine aufregende Zeit: „In den nächsten zehn Jahren werden wir in der Lage sein zu zeigen, ob wir die Lebensspanne des Menschen um 10 oder auch um 20 Jahre verlängern können.“ In Singapur leitet Maier Versuchsreihen mit bereits zugelassenen Medikamenten. Weltweit werden derzeit rund 20 Wirkstoffe getestet, die eigentlich gegen Krankheiten wie etwa Diabetes oder Krebs eingesetzt werden, die aber auch das Altern erheblich beeinflussen könnten. Untersucht werden müssen etwa die genaue Dosierung und langfristige Nebenwirkungen.
Ein anderer derzeit viel beachteter Ansatz in der Alternsforschung dreht sich um sogenannte seneszente Zellen, auch Zombiezellen genannt. Claudia Waskow, Immunologin am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena, erklärt das Problem: „Das sind Zellen, die sich nicht mehr teilen können, die aber Botenstoffe freisetzen“ – und damit ihrer Umgebung schaden können. Bei Mäusen gelingt es, Zombiezellen gezielt auszuschalten, und das trägt zur Langlebigkeit des gesamten Organismus bei.
Wirkstoffe, sogenannte Senolytika, sollen den Zombiezellen auch im menschlichen Körper zu Leibe rücken. Noch sind diese Medikamente aber nicht ausreichend getestet – und es gibt Nebenwirkungen. Generell geht die Forschung davon aus, dass es nicht die eine Pille oder den einen Ansatz gegen das Altern geben wird. Es wird eine Kombination aus gesundem Lebensstil und Wirkstoffen sein, die uns ein längeres und gesünderes Leben ermöglicht. Doch dazu müssen wir verstehen, was Altern überhaupt ist, und das ist sehr komplex. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 25.06.2022 arte Deutsche Online-Premiere Di 21.06.2022 arte.tv Können wir ohne Landwirtschaft leben?
Folge 38 (25 Min.)Fast alles, was wir essen, kommt heute aus Ackerbau und Viehzucht. Felder, Weiden und Ställe bedecken den größten Teil der Landfläche der Erde. Eine Welt ohne Landwirtschaft können wir uns kaum vorstellen. Doch vielleicht müssen wir trotzdem nach Alternativen suchen. Denn Landwirtschaft ist einer der größten Treiber für eine Multikrise. Eine Kombination von Artensterben, Klimawandel, Bodendegradation und wachsender Weltbevölkerung, die ohne revolutionäre Veränderungen der Landwirtschaft kaum zu stoppen ist. Könnte zelluläre Landwirtschaft ein Teil dieser Revolution werden? Lebensmittel, die nicht aus Pflanzen oder Tieren stammen, sondern aus großen biotechnologischen Anlagen? Also Bioreaktoren, eine Art Hightech-Braukessel, in denen lebende Zellen sich unter optimalen Bedingungen rasant vermehren.
Für Fleisch gehen diese Verfahren gerade in die großtechnische Anwendung, für Milchprodukte und Fisch steht das kurz bevor. Noch größeres Potenzial sehen Forscherinnen und Forscher bei pflanzlichen Zellen. Diese lassen sich einfacher vermehren als tierische Zellen – und das kann prinzipiell jede Pflanzenart.
Im Labormaßstab funktioniert schon die Produktion von Beerenmus, Kaffee oder sogar Holz. Müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass unser Essen in Zukunft komplett aus Bioreaktoren kommt? So schnell wahrscheinlich nicht, denn die Technik ist teuer, kompliziert – und im Fall von Fleisch – energieaufwendig. Für Produkte mit mieser Ökobilanz wie Avocados oder Kaffee könnte es sich aber lohnen. Sollten wir post-landwirtschaftlichen Revolution eine Chance geben, auch wenn dadurch nur ein Teil der Ställe und Äcker überflüssig wird? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 02.07.2022 arte Wie gefährlich ist das Weltraumwetter?
Folge 39 (29 Min.)Für Juha-Pekka Luntama, Koordinator für Weltraumwetter bei der European Space Agency (ESA), stellt sich nicht die Frage, ob Weltraumwetter unsere technologisierte Welt aus dem Takt bringen wird, sondern vielmehr wann die Zeichen auf Sturm stehen. Im März 1989 kam es beim schwersten kosmischen Unwetter des 20. Jahrhunderts zur Selbstabschaltung eines Kraftwerks. Anschließend lag das gesamte Stromnetz der kanadischen Provinz Québec brach. Damals machte das World Wide Web seine ersten Schritte, die Satellitennavigation steckte in den Kinderschuhen. Ein ähnlicher Sonnensturm könnte heute viel dramatischere Folgen haben, betont Juha-Pekka Luntama.
Denn inzwischen sind unzählige Branchen nicht nur abhängig vom Internet, sondern auch von der Satellitennavigation. Besorgt sind Expertinnen und Experten auch mit Blick auf unsere Stromnetze: Ein erdgerichteter koronaler Massenauswurf würde die Erde regional elektrisch aufladen. „Darauf reagieren vor allem die Transformatoren anfällig. Unsere Stromnetze könnten aus dem Takt geraten, Blackouts wären die Folge“, sagt Stromexperte Prof. Herwig Renner. Leider sind wir in der Vorhersage solcher Ereignisse noch immer ungefähr da, wo wir bei der Vorhersage irdischen Wetters in den 50er Jahren waren.
„Wenn es darauf ankommt, haben wir im besten Fall eine Sturmwarnsirene“, sagt Tamitha Skov. Die Physikerin ist die Erste, die das Weltraumwetter regelmäßig im Internet einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. „Noch haben wir den Heiligen Gral der Weltraumwettervorhersage nicht geknackt“, meint auch der Direktor der NASA-Sonnenforschung Antti Pulkkinen, aber Weltraummissionen wie Parker Solar Probe und Solar Orbiter liefern der Wissenschaft derzeit spannende neue Daten über die Vorgänge auf der Sonnenoberfläche. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 09.07.2022 arte Werden wir wirklich zum Mars reisen?
Folge 40 (20 Min.)NASA space station landing on MarsBild: Curiosity ChannelDer Astrobiologe Cyprien Verseux von der Universität Bremen will seit seiner Kindheit Planetenforscher werden und hofft, selbst vielleicht noch zum Mars reisen zu können, um dort zu forschen. Unternehmer Elon Musk will mit seiner Raketenfirma SpaceX schon bald eine Million Siedlerinnen und Siedler zum Mars fliegen, die dort eine sich selbst versorgende Stadt errichten. Elon Musk will den Mars zum Planeten B machen; zu einer zweiten Erde, falls unsere Erde nicht mehr bewohnbar sein sollte. In der Wissenschaft gelten Musks Pläne als umstritten bis absurd.
„Ich denke, dass wir mittelfristig eher daran interessiert sein werden, Forschungsbasen zu errichten, mit Besatzungen, die sich abwechseln, vielleicht wie derzeit in der Antarktis“, sagt Cyprien Verseux. Die Sehnsucht danach, auf dem Mars zu leben, erklärt der Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson mit der Sehnsucht nach einem Neustart. Das Bedürfnis, den persönlichen, irdischen Realitäten zu entfliehen. Der Wunsch, noch einmal von vorne anzufangen. Nicol Caplin von der Europäischen Weltraumorganisation ESA hält Marsmissionen nach dem heutigen Stand der Technik noch nicht für möglich.
Erst einmal müsse man Erfahrungen mit den geplanten Mondreisen sammeln. Doch auch wenn die ESA und die amerikanische Weltraumagentur NASA noch keine künftigen Missionen zum Mars planen, forschen sie bereits, wie sie in Zukunft Menschen zum Mars bringen könnten. Inspiration kommt aus der Science Fiction; etwa die Idee, Crews während der 260 Tage Anreise zum Mars in Kälteschlaf zu versetzen, um Gewicht für Wasser und Nahrung einzusparen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 16.07.2022 arte Deutsche Online-Premiere Mi 13.07.2022 arte.tv Kann Geld aus dem Nichts entstehen?
Folge 41 (29 Min.)Woher kommt eigentlich Geld? Viele denken, dass es so funktioniert: „Der eine spart, der andere braucht Geld, das er noch nicht hat. Das muss organisiert werden. Das nennt man Bank. So einfach ist das.“ Das stimmt nicht. Wenn ich zur Bank gehe und mir Geld leihe, etwa um eine Wohnung zu kaufen, dann schafft die Bank das Geld für den Kredit in dem Moment, in dem ich den Kredit aufnehme. Aus dem Nichts. Das klingt nicht weiter problematisch, doch Experten mahnen schon seit geraumer Zeit, dass Geschäftsbanken dieses Geldschöpfungsprivileg ausnutzen.
Im Rahmen der Deregulierung der Banken in den 1980er Jahren haben Staaten weltweit viele Regeln der Kreditvergabe abgeschafft. Es ist heute den Banken überlassen, für welchen Sektor sie neues Geld schöpfen. So fließt viel Geld in Spekulationen, Aktienmärkte und komplizierte Finanzprodukte, doch die wirklich wichtigen gesellschaftlichen Projekte wie Bekämpfung des Klimawandels oder der Armut sind unterfinanziert. Wie könnten wir das ändern? Müssen wir die Banken abschaffen? Oder sollten wir die Regeln für Kreditvergabe wieder einführen? (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 23.07.2022 arte Deutsche Online-Premiere Do 23.06.2022 arte.tv Wie werden wir Kriege los?
Folge 42 (29 Min.)Bild: ArteEs gibt über 13.000 Atomwaffen auf der Welt. Genug, um uns alle auszulöschen. Mehrfach. Solche Zahlen und die aktuellen Kriegsbilder können Angst machen. „42 – Die Antwort auf fast alles“ versucht, konstruktiv und so sachlich und wissenschaftlich wie möglich an die Sache heranzugehen. Ein bewährtes Mittel gegen Krieg sind gute Verhandlungen. In der Vergangenheit konnten so bereits Kriege beendet werden. Der Anthropologe William Ury, der Verhandlungen erforscht und das Harvard Negotiation Project mitgegründet hat, zeigt Strategien, die zu einem Friedensschluss führen können.
Angelika Rettberg, Politikwissenschaftlerin von der Universität der Anden in Kolumbien, berichtet, worauf es im Friedensprozess mit der Guerilla-Gruppe FARC ankam. Noch besser wäre es, Kriege zu erkennen und zu verhindern, bevor sie ausbrechen. Der Konfliktforscher Håvard Hegre an der Universität Uppsala in Schweden entwickelt ein Frühwarnsystem für bewaffnete Konflikte und zeigt erste Ergebnisse. Und was lässt sich grundsätzlich tun, um Frieden zu erhalten? Schon Immanuel Kant glaubte, die Lösung gefunden zu haben: Die Staatsform der Demokratie führe zu ewigem Frieden, wenn das Volk mitreden dürfe.
Und die Forschung bestätigt die Behauptung, dass zumindest Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Frieden zu schaffen und zu erhalten – etwa mit Hilfe der Demokratie – habe auch direkt etwas mit uns selbst zu tun, betont die Friedensforscherin Ursula Schröder. Trotz der aktuellen Kriege meint sie: „Es gibt keinen Grund zu sagen, dass die politische Utopie eines Weltfriedens nicht umsetzbar sein könnte.“ (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa 30.07.2022 arte Deutsche Online-Premiere Mi 13.07.2022 arte.tv
zurückweiter
Erinnerungs-Service per
E-Mail